Calcio Basilea - Fussball und Migration
(Fussball - die Weltsprache)
„Die Migration ist ein wichtiger Bestandteil der modernen Gesellschaft. Die Schweiz hat auf diesem Gebiet Vorbildcharakter: Hier leben drei Millionen Menschen mit Migrationshintergrund – die meisten sind gut integriert. Das ergibt eine lebendige gesellschaftliche Mischung, neue Qualitäten, mehr Know-how, nicht zuletzt im Fussball. Viele Secondos verfügen über mehr Begeisterung und Talent als Einheimische. Der Fussball bietet ihnen die Möglichkeit, Träume zu verwirklichen, die eigenen Grenzen hinter sich zu lassen. Auf dem Fussballplatz sind alle gleich. Es gibt keine sozialen Unterschiede. Es ist wohl nirgends so schnell ein sozialer Aufstieg möglich wie im Sport – und da spreche ich nicht nur für den Spieler selber. Die ganze Familie kann davon profitieren. Dies ist bei Immigranten sicher ein verstärkender Antrieb (...)
Die Schweiz ist so stark, weil sie es schafft, viele Kulturen zusammenzubringen. Das Multikulturelle ist der vielleicht grösste Trumpf der Schweiz überhaupt. Und der Fussball ist dafür ein wunderbares Vorbild“ (Ottmar Hitzfeld 2018 in einem Gespräch mit Thomas Renggli)
[nachfolgende, einführende Zitate sind dem Buch 'Das Jahrhundert der Italiener in der Schweiz' entnommen]
„Das Jahrhundert, in dem die italienischen Immigranten erst die auffälligste und später mit Abstand zahlreichste ausländische Minderheit in der Schweiz waren, beginnt in den frühen 1870er Jahren mit dem Bau der Gotthardbahn – nachdem der Niederlassungs-Konsularvertrag von 1868 im Sinne des Liberalismus klare Verhältnisse geschaffen hatte – und es endet im Laufe der 1980er Jahre. Die italienische Diaspora – schätzungsweise haben sich in diesem Zeitraum rund fünf Millionen Italiener und Italienerinnen als Arbeitskräfte in der Schweiz aufgehalten - ist heute stark geschrumpft“ (Ernst Halter)
„In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts hatte sich die Schweiz in eine riesige Baustelle verwandelt. Die grossen Strassen- und Eisenbahnbauten, die Trockenlegung der Sumpfgebiete, die Begradigung der Wasserläufe, aber auch das Wachstum der grösseren Städte hatte eine immense Masse von (hauptsächlich italienischen) Arbeitskräften angezogen“ (Tinardo Gatani)
„Machten die Italiener 1850 noch weniger als 10% der Ausländer in der Schweiz aus, so stieg ihr Anteil bis 1910 auf annähernd 37%, womit sie die Franzosen weit hinter sich gelassen und beinahe zu den Deutschen aufgeschlossen hatten. Schätzungsweise drei Viertel stammten aus Nord-, knapp ein Viertel aus Mittelitalien. Insgesamt betrug der Ausländeranteil 1914 16%. 1910 waren 40% der Bauarbeiter Ausländer. Von den in der Schweiz erwerbstätigen Italienern arbeiteten 44% auf dem Bau“ (Adrian Knoepfli)
„Politische und wirtschaftliche Gründe führten dazu, dass in der Zwischenkriegszeit die Immigration aus Italien eher rückläufig war. Während 1910 noch 202'809 Italiener in der Schweiz lebten, waren es 1920 noch 134'644 und 1930 schliesslich lediglich 127'093. Zu diesen Zahlen addiert werden müssen die Saisonarbeiter (…) Die Einbürgerungen pendelten zwischen 1913 und 1930 auf einem jährlichen Mittel von 1013 Personen (…) Ab 1924 verbesserte sich die Lage auf dem schweizerischen Arbeitsmarkt und der Bedarf an italienischen Arbeitskräften stieg namentlich im Baugewerbe und Dienstleistungssektor bis 1930 kontinuierlich. Um den Anteil der ausländischen Bevölkerung nicht zu erhöhen, wurde der kurzfristige Aufenthalt zum Prinzip erhoben (Rotationsprinzip). Die Italiener sollten als Saisonarbeiter nur als Aufenthalter betrachtet werden (...) Mit der Annahme des Bundesgesetzes vom 26.3.1931 über den Aufenthalt und die Niederlassung der Ausländer und der entsprechenden Vollzugsverordnung vom 5.5.1933 verfügte die Schweiz über einen Gesetzesapparat zur Regulierung der Immigration auf dem Arbeitsmarkt. Am 1.8.1934 trat die Erklärung vom 5.3.1934 über die Anwendung des Niederlassungs- und Konsularvertrages vom 22.7.1868 zwischen der Schweiz und Italien in Kraft. Sie garantierte italienischen Staatsbürgern, die sich während einer Dauer von fünf Jahren ununterbrochen regulär in der Schweiz aufgehalten hatten, den Anspruch auf bedingungslose Erteilung einer Niederlassungsbewilligung. Diese Personen hatten von nun an das Recht, Arbeitsplatz, Beruf und Wohnort frei zu wechseln“ (Gérald und Silvia Arlettaz)
„Die drei Jahrzehnte zwischen 1945 und 1974 waren in der Schweiz Jahrzehnte der italienischen Einwanderung im ganz grossen Stil (…) 1948 wurde die Anwesenheitsdauer, die einem Ausländer den Anspruch auf dauernde Niederlassung in der Schweiz gab, auf zehn Jahre erhöht (…) 1949 wurde der Stellenwechsel für bewilligungspflichtig erklärt (…) Ein Hauptpfeiler der Einwanderungspolitik bestand in der Verwehrung des Familiennachzugs. 1960 folgten neue Richtlinien, die den Familiennachzug generell nach drei Jahren ununterbrochenen Aufenthalts zur Regel erhoben“ (Josef Martin Niederberger)
1960: rund 346'000 Italiener in der Schweiz.
1964: Migrationsabkommen brachte erhebliche Verbesserungen für italienische Arbeitskräfte. Neu konnte nach fünf Jahren der Arbeitsplatz und Wohnsitz gewechselt werden und Saisonniers erhielten eine Jahreaufenthalter-Bewilligung. Behörden gestatteten nach 18 Monaten statt wie bisher 36 der Ehefrau und den minderjährigen Kindern den gemeinsamen Wohnsitz mit dem Familienhaupt (erleichterter Familiennachzug).
1970: annähernd 600'000 Italiener lebten in der Schweiz.
1974: im Zeitraum von vier Jahren verschwanden während der Wirtschaftskrise etwas 300'000 ausländische Arbeitskräfte mit Ausweisen A und B vom schweizerischen Arbeitsmarkt.
1982/83: die Beschäftigung ging durch die Rezession um 2% zurück, davon 47% Abgang ausländischer Arbeitskräfte.
Von Mitte der 60iger Jahre bis 1975 erschien im Anzeiger Baslerstab zehn Jahre lang wöchentlich die Beilage 'Per Voi' mit Verkaufsinseraten, Stellenanzeigen, Wohnungsangeboten und vielem mehr als Informationsangebot für die italienischen Gastarbeiter.

Unione Sportiva Italiana Basilea - etwas Heimat in der Fremd (Foto undatiert)
Drehen wir das Rad trotz vieler nicht mehr existierender Clubs und der spärlichen Quellen noch einmal zurück. Bei den Congeli brachten noch vor der offiziellen Gründung 1907 die Ferralli-Buben die Ballen aus dem eigenen Quincailleriewaren-Geschäft auf die Margarethenwiese: die Familie war aus Genf in die Region gekommen. Die Jubiläumsschrift des FC Allschwil erwähnt die Mühleweg-Kickers, die sich vor allem aus Italienern rekrutiert und in der kargen Freizeit leidenschaftlich Fussball gespielt haben sollen. Unter den Initianten von Fortuna Birsfelden finden sich die Herren Guerrino und Santi. Einflüsse der Zuwanderer, die ab etwa 1890 vor allem als Bauarbeiter in die Region gelangten, hat es also bereits vor der Gründung des 'Italienischen Sportvereins Basel' 1922 gegeben.
USI Bottecchia (I):
Die auch dem Radsport verschriebene Unione Sportiva Italiana Basilea verlor das Finalspiel um die erste (offizielle) Baselstädtische Meisterschaft gegen den FC Fortuna nach Verlängerung mit 0:1. Danach wurde sie wegen Nichterfüllung finanzieller Verpflichtungen wieder gelöscht.
Ab 1928 führte die USI, welche ihr Terrain etwas ausserhalb bei der Gartenstadt in Münchenstein bezog, zu Ehren des gewaltsam ums Leben gekommenen Tour de France-Siegers Ottavio Bottecchia seinen Namen im Anhang. 1933 wurde dem zweiten Aufnahmegesuch vom Schweizerischen Verband stattgegeben. Der Club stieg von der 4. in die 2. Liga auf („die Italo-Basler haben eine äusserst harte und schnelle Mannschaft zur Stelle“) und auch seine A-Junioren, welche 1942 in den Finalspielen gegen Basel und Laufen standen, trafen nun auf namhafte Gegner. 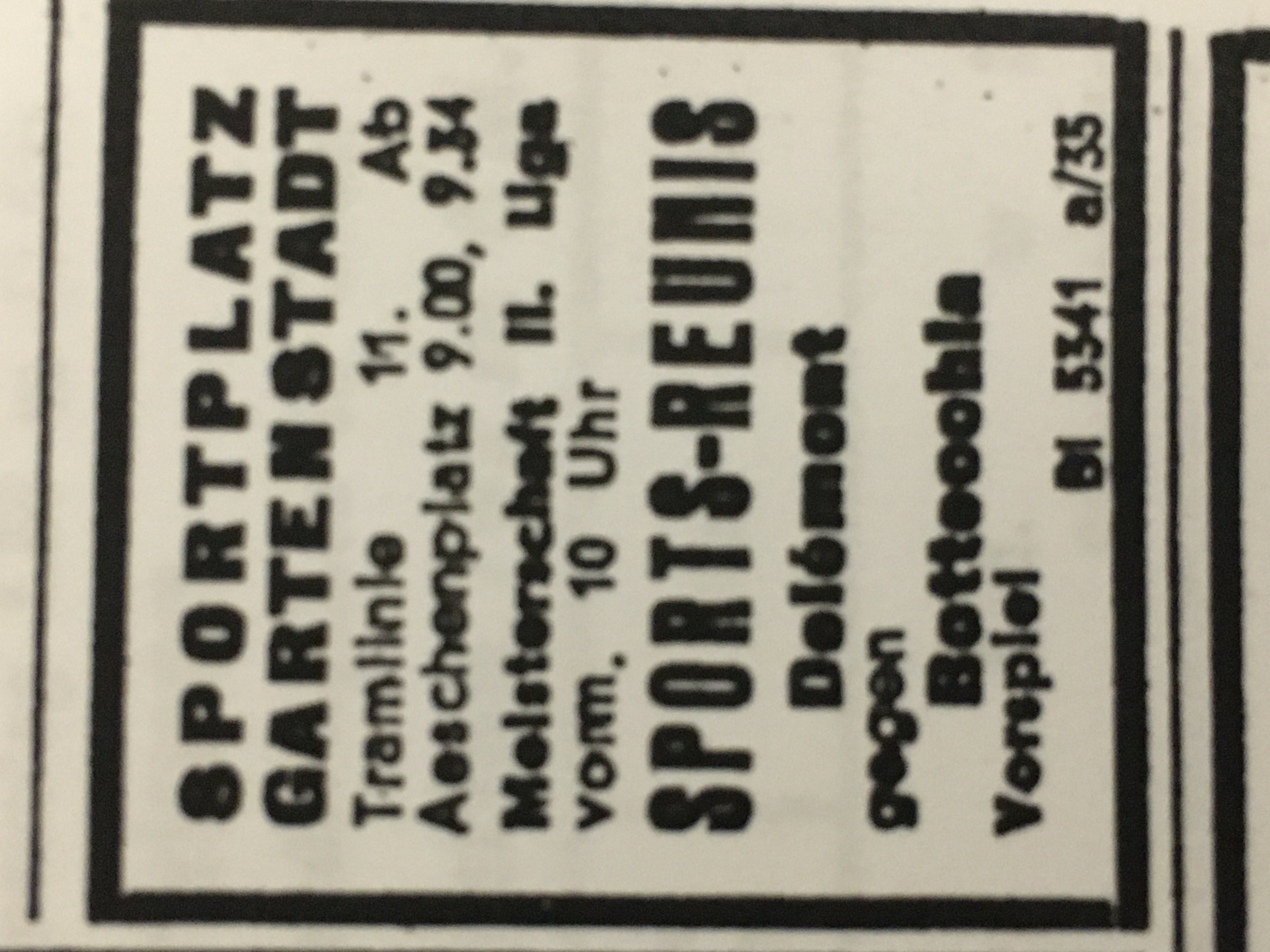
Präsident von 1932 bis 1944 war der 1895 geborene und als 10jähriger nach Basel gekommene Giovanni Morellini, der dieses Amt schon bei den Old Boys (Stammverein) bekleidet hatte. Morellini hatte sich aus bescheidenen Anfängen zum Geschäftsmann im Südfrüchte- und Gemüsehandel emporgeschafft. Den Spielbetrieb leitete während einiger Jahre der Bruder des FIFA-Schiedsrichters Jacques Hirrle Hans Hirrle.
Auf dem Dreispitz (Platzwechsel) soll man vor bis zu 2000 Landsleuten aufgetreten sein (Jubiläumsschrift).
Beachtlich waren auch die Resultate in den Cup-Wettbewerben, wo sogar dem Serie A-Vertreter Concordia die Stirn geboten wurde (1. Hauptrunde 7.10.1934 mit Wascher; Zampieri, Tomasina [ex Black Stars, später SC Kleinhüningen]; Hediger, Müller, Consigli [ex Nordstern]; Trümpi, Ganter, Casola, Spadini, Guldimann).
2:1 Finalsieg im Basler Cup 1935 über Riehen mit Wascher; Grunder, Zampieri; Consigli, Mutter, Sofia; Spreng, Ganter, Spadini, Borchetti, Guldimann („erneut zeigt die Mannschaft ihr altbekanntes Spiel, nur durch den Mittelläufer den Aufbau besorgen zu lassen, die Flügelhalves jedoch in die Verteidigung zurückzunehmen“). Guglielmo Spadini wechselte im selben Jahr zurück zu seinem Stammclub FC Basel. Seine spezielle spielerische Technik verschaffte Spadini, der fünfzig Jahre lang als Schuhmachermeister an der Webergasse ein Begriff war, grosse Beliebtheit.
Anlässlich der Begegnung Ambrosiana gegen Juventus Turin am 31.3.1935 durfte Bottecchia gegen die Profi-Reserven das (0:5 verlorene) Vorspiel bestreiten, bei dem die Stadt Mailand eine Rekordkulisse von 34000 Zuschauern verzeichnete.
Wie in Zürich zog die Politik offenbar in den Verein ein. „Die dortige SCI Juventus war vom Konsulat unterstützt und Teil des Faschismus. Sie erhielt generöserweise Fussballer aus Italien zur Verstärkung. Das Sponsoring verhalf Juventus 1933 zum Aufstieg in die zweithöchste Liga“ (Zitat Carlo Bernasconi). Auch in Luzern war mit Sparta Luzern ein italienischer Fussballclub faschistischen Einschlags gegründet und im Juni 1931 in den SFAV aufgenommen worden.
Unter dem Namen Gruppo Sportivo dei Operai Italiani schlossen sich 1931 italienischsprechende Arbeiter in Basel zu einem Sportclub zusammen, „um nicht bei den unter dem Faschisten-Konsul stehenden Bottecchia mitwirken zu müssen“ (Basler Vorwärts): sie traten als 'Italia' dem 'Rotsport' bei.
1940/41: USI Bottecchia - FC Allschwil mit Greder; Gerber, Zampieri; Tombetti, Burato, Anceschi; Ros, Mingucci II, Mohler, Patelli, Ferraresi (3. Liga, Gruppe 2). Bottecchia II spielte in der 4. Liga.
Basler Cupfinal 1941 mit Blaser; Mutter, Dienger; Anceschi, Burato, Boschetti; Ros, Ganter, Mohler, Zampieri, Ferraresi (im Kader Casola, Esposito, Graser, Mingucci, Patelli).
Calciatore tra le due guerre - assi, eroi locali:
Seinen Einstand im Fanionteam des FC Basel gab am 22.11.1925 der aus einer seiner unteren Mannschaften nachgezogene und dem FC Alemannia entstammende Armando Ardizzoia (später FC Riehen). Sein Bruder Enrico (später FC Rot-Schwarz) debütierte am 7.4.1935 gegen Young Fellows Zürich.
Der FC Black Stars verdankte den Aufstieg in die höchste Liga seinen Stürmern Angelo Casola (später USI Bottecchia) und Angelo Sormani. Der Club, der viele Jahre von Anton Giavarini präsidiert wurde, hatte von den grossen Basler Vereinen den stärksten südlichen Einschlag. Sormani, dessen Söhne ebenfalls bei Black Stars spielten, übernahm später an der Allschwilerstrasse eine Wirtschaft. Der langjährige Platzspeaker Mario Casadei (Beitritt 1934) soll mit seinem Wechsel zum damaligen Erstligisten FC Olten, für den er mit dem Segen des SFAV monatlich 20 Franken plus ein Strecken-Abonnement erhielt, der erste bezahlte Amateurfussballer der Schweiz gewesen sein. Der Vater von Arthur Gatti (Trainer ab 1967/68, sein Cousin Bruno Gatti wurde 1963 mit dem FC Basel Cupsieger) führte lange das Clublokal.
Auf die Saison 1930/31 wechselten die Gebrüder Racchi vom FC Allschwil zum FC Concordia.
Die Leitung bei seinem Stammverein übernahm nach seiner Zeit beim FC Basel, wo auch sein Bruder Willy spielte, als Sturmführer 1937 der Tessiner Gaspero Monigatti. Die Familie war 1932 nach Binningen gezogen. Am 16.9.1934 wurde er zusammen mit Ennio Martinoli (FC Nordstern, FC Concordia, FC Breite) in die Stadtelf gegen Frankfurt berufen. Sein Clubkollege Leo Lorenzini hatte Ende 1926 bei den Old Boys (mit Cattori) debutiert.
Der Birsfelder Terzo Longhi (1911-2000) stand neben Alberto Losa, der sich zur Erlernung der deutschen Sprache 1938 vom FC Locarno angeschlossen hatte, 1939 mit Nordstern im Cupfinal und war von 1951 bis 1959 Trainer des FC Breite. Eine Berufung in die Schweizerische Nationalmannschaft blieb ihm verwehrt, weil die Longhis erst 1952 eingebürgert wurden. Aus Birsfelden stammte auch der langjährige Goalie des FC Basel Ernst Zorzotti (1918 bis 1931).
Der Luganesi Rodolfo Kappenberger zog 1941 ans Rheinknie, um Zahnmedizin zu studieren. In die Zeit beim FC Basel fielen seine sechs Länderspiele.
Vereinspräsident des FC Nordstern von 1939 bis 1942 war Mario Mauli, der ab 1945 auch viele Jahre im Vorstand des Regionalen Fussballverbandes einsass.
In der Chronik des FC Fulgor Grenchen steht, dass eine Beschränkung auf höchstens zwei Schweizer rasch fallengelassen wurde. Wie sah es (umgekehrt) mit der Integration in die einheimischen Mannschaften aus? Welche Hindernisse stellten sich für die Italiener in den Weg, ihrer Leidenschaft bei uns nachgehen zu können?
Das Gruppenfoto des SC Binningen zeigt 1926 die Herren Cantaluppi, Moroni, Pistoresi, Simonini und Lorenzini: unter den Gründern 1920 waren Archimedes Lorenzini, Natale Bianchi und Angelo Moroni, zu denen sich bald Pietro Pistoresi, Lino Monteverdi und Dino Simonini gesellten. Die Glanzzeit des FC Münchenstein der 20er-Jahre (Serie B) prägten Spieler wie Cordazzo, Favro oder Rossi. Auch in einem Matchtelegramm des FC Allschwil, wo wegen der Ziegeleiindustrie ein grosses Ausländerkontingent beschäftigt war, figurierten 1929 nicht weniger als fünf italienischsprachige Namen: deren Qualität und Begeisterung für den Fussball liess jedenfalls in den Basler Vororten, die sich ab 1920 sprunghaft entwickelt hatten, keinerlei Fragen offen.
Beim Promotionsrivalen Liestal wurde 1927 („nach dem Urteil einiger Liestaler selbst“) als Seele der Residenzler Cattori genannt, der auch Mitglied der Landesauswahl der Schweizerischen Universität war, und 1933 als eine ihrer Stützen Soverini.
25 Jahre FC Gelterkinden 1934 mit Bruno und Paul Botta, Guido und Luigi Brenna sowie Arturo Mazzon.
FC Birsfelden 1936 mit Longhi, Malzanini, Pini, Rimondini und Tarelli. Der Baselbieter Cup-Finalist FC Pratteln spielte mit dem in Zürich aufgewachsenen Bruno Puppato, der als jüngster Sohn einer Einwanderfamilie den Beruf eines Maurers erlernte und als Torhüter quasi von der Vereinsgründung an alle Erfolge von der 4. Liga bis zu den Aufstieggsspielen in die NLB erlebte und Martini.
SC Binningen gegen Rasenspiele Basel im Mai 1936 im dritten Ausscheidungsspiel mit Simonini, Piccoli I und II. In den Vorstand gewählt wurden als Vize-Präsident anstelle von Leo Lorinzini Bruno Cantaluppi anstelle und Pietro Pistoresi als Spiko-Präsident für Gaspero Monigatti (Clubchronik).
Zu den ersten Ehrenmitgliedern ernannte der FC Rheinfelden 1939 Walter und Alfred Rigassi, die die Geschichte des Vereines ab 1916 entscheidend geprägt und sein Rückgrat gebildet hatten. Im selben Jahr (und bis 1949) stand dieser unter der Leitung von Arturo Berri.
August Pozzi gilt als grosser Förderer der Juniorenbewegung des FC Laufen (ab 1941).
Auswahlmannschaft des Baselstädtischen Verbandes gegen Solothurn vom 1.1.1932 mit Casola, Tomasina (beide FC Black Stars) und Marioni (FC Riehen).
Auch in den Kadern der Kleinbasler Arbeitervereine wie dem langjährigen Dominator Vereinigte Sportfreunde stösst man auf die Einwanderung aus dem Süden (Zampieri, Bandini, Leonardi, Ottolini - FC Nordstern, Rizzini).
Erster Verbandsmeister 1921 FC Fortuna Basel mit De Petri und den Gebrüdern Zampieri.
Basler Stadtmannschaft des Arbeiterfussballverbandes im April 1930 mit Burato (Union Breite), Laghi (AFC Sparta) und Ottolini (FC Grasshoppers). Satus-Stadtauswahl der Jahre 1933 und 1934 mit Goalie Ragazzi, Barcchi (beide Neue Sektion), Porzellini, Soltatti (beide FC Fortuna) und Ballerini (ATSV Riehen).
Vitale Villa (Jahrgang 1906) gehörte zu den Mitbegründern des FC Ouvrier Bourgfelden und der Ball-Boys.
Als gute Seele bei Amicitia Riehen und Starthelfer der Juniorenabteilung bleibt Bruno Righetti in Erinnerung, Präsident von 1947 bis 1965 war Emil Ruffato.
US Ticinese Basilea (I):
Am 14. Mai 1927 zeigte an einem Turnier in Kleinhüningen erstmals die Unione Sportiva Ticinese vor, was sie geübt hatte:
„Der Tessiner spielt Fussball, wie er irgendetwas anderes tut, das ihm am Herzen liegt: nämlich rasch und mit viel Temperament“ (NZ). „Lachende Burschen mit dunklen Haaren und weissblitzenden Zähnen, voller Laune und köstlichem Humor, die sich schon auf den ersten Blick von der behäbigen Gemütlichkeit der Deutschschweizer unterscheiden“, hiess es im Bericht von einer Jahresfeier. Eine Tessiner-Mannschaft hatte sich schon nach 1919 bei den Old Boys ergeben.
Beim Propagandatreffen gegen Bottecchia am 22.2.1931 (Ticinese mit Mauli; Radaelli, Lupi II; Ferrari, Pedrini, Zorzi; Regli, Rezzonico, Lupi I, Rufflex, Pellegrini - Präsident Buzzolini) debütierte der Ex-Chiasso-Stürmer und Internationale Giovanni Lupi, der in der Saison 1931/32 beim FC Basel unter Vertrag stand und später beim SC Olympia Basel und FC Liestal mitwirkte.
Ticinese Baselstädtischer Meister 1934/35 mit früheren Serie A-Spielern: Buratto II; Rezzonico, Hägele; Regli, Bucco I, Buratto III; Schott, Berguglia, Müller, Berbet, Bucco II.
Ticinese und Bottecchia mussten sich 1936 und 1943 dispensieren lassen („der US Ticinese ist es infolge Spielermangel unmöglich geworden, eine Mannschaft für die Zwischenmeisterschaft starten zu lassen“) und gründeten sich nach dem Kriege neu.
Mit dem FC Chiasso, der damals in die italienischen Serie A integriert war, trat anlässlich der Tessiner-Tage der Schweizer Mustermesse im April 1922 als Gast des FC Nordstern erstmals eine Mannschaft aus dem Südkanton in Basel an.
Eine Basler Stadtmannschaft (Grüneisen - FCN; Oberhauser - FCN, Riederer - FCB; Heidig - FCN, Huber, Barrer - beide Concordia; Breitenstein - FCN, Lehmann - FCB, Bucco - FCN, Oberer - FC Concordia, Wüthrich - FCB) unterlag im Januar 1928 auf dem Campo marzo der Tessinerelf Chiasso/ Lugano mit 2:5.
Brutte notizie dal Ticino:
Der sportliche Verkehr mit der Südschweiz, deren Vertreter sich in Anbetracht ihrer exponierten geografischen Lage als die 'Sudetenfussballer der Schweiz' zu nennen beliebten, verlangte dem SFAV erhebliche finanzielle Opfer ab. Die Eigenart, die den Tessinern nachgesagt wurde, löste Faszination aus, aber bestärkte auf der anderen Seite die Vorurteile.
Im Februar 1924 musste das Spiel Lugano - Blue Stars auf dem Campo Marzo vom Basler Schiedsrichter Herren „nach einer unwürdigen Lärmszene infolge eines Handspenalty“ abgebrochen werden, wonach dieser vom Publikum mit Faustschlägen ins Gesicht „misshandelt“ wurde.
1925 wurden in Chiasso der Unparteiische und Spieler von Neumünster verprügelt, die sich in ein Haus in der Nähe des Bahnhofs und mit Hilfe der Polizei auf den Zug nach Lugano retten konnten. Der Basler Schiedsrichter Jordan erreichte am 24. April 1938 anlässlich der Begegnung FC Chiasso gegen Juventus Zürich den Bahnhof nur unter Polizeischutz, nachdem er vom Publikum mit Steinen beworfen und von einem Spieler getreten worden war.
„Basels Mannschaft wurde per Schiff in Sicherheit gebracht. (...) Es war dem FC Basel nicht möglich, den Basler Schnellzug von halb 5 zu benützen, da sich vor dem Bahnhof in Lugano eine grosse Menschenmenge angesammelt hatte, die eine bedrohliche Haltung annahm. So mussten schliesslich die bereits durch Tätlichkeiten verletzten Basler Fussballspieler mit polizeilicher Bewachung im Auto nach Chiasso gebracht werden, wo sie im Laufe der Nacht abreisen konnten (...) Spieler und Schiedsrichter waren [gemäss einer Stellungnahme des Präsidenten des FC Basel] auf dem Platz vollständig ohne Schutz und in Lebensgefahr“ (Berichterstattung zum Cup-Sechzehntelfinal FC Lugano - FC Basel vom 22.11.1931, NZ)
„Wir erachten es als unsere Pflicht, über Vorfälle anlässlich des Spieles Chiasso - Black Stars vom letzten Sonntag kurz Bericht zu erstatten. 1. Der Black Stars-Spieler Tomasina wurde vom Platze gewiesen. Diese Massregelung erfolgte erst, nachdem das Publikum in das Spielfeld eingedrungen war und mit Drohungen Spieler und Schiedsrichter überhäufte (...) Der FC Black Stars sieht sich gezwungen, im Interesse der Sicherheit seiner Mitglieder von weiteren Spielen im Tessin abzusehen, solange nicht vom Verbande selbst weitgehende Schutzmassnahmen getroffen werden“ (Der Spielführer: sig. H. Roth - Dezember 1931)
2.4.1944 Abbruch US Pro Daro (Bellinzona) - SC Zug (Prügeleien zwischen Spielern und Zuschauern): „Bellinzona und Pro Daro standen sich in einem Schweizer-Cup-Spiel gegenüber. Der Kampf wurde von beiden Seiten mit dem ganzen Aufwand des lokalbedingten Temperamentes durchgeführt. Tote und Verletzte gab es keine: immerhin musste der Kampf vorzeitig abgebrochen werden, weil sich das ebenfalls warmgelaufene Publikum als in der Mehrzahl erwies und eine Fortsetzung des Spieles verhinderte“ (NZ 1940)
Bellinzona, Lugano, Locarno, Chiasso oder Mendrisio galten auch noch in den 50er Jahren als heisse Pflaster. Deutsch- und Westschweizer Clubs reisten nur mit grössten Bedenken in den 'Brennpunkt Tessin' - und das nicht wegen der Pfeifkonzerte, die auch minutenlang anhalten konnten (FC Locarno - FC Basel 24.4.1949).
Über die Begegnung FC Lugano - FC Basel am 14.11.1954 berichtete der Captain Hans Hügi von 'Unsportlichkeiten am laufenden Band', und dass die vom Lautsprecher noch aufgestachelten Tessiner von Anfang an darauf ausgegangen waren, die Basler kampfunfähig zu machen. Der Basler Torhüter Schley musste bewusstlos ins Krankenhaus überführt werden, nachdem er am Boden liegend knapp unterhalb der Schläfengegend getroffen wurde. Beim Verlassen des Spielfeldes wurden die Basler mit Fusstritten und Ohrfeigen attackiert und mit faustgrossen Steinen beworfen. Die Mannschaftsbegleiter sahen sich vor der versperrten Kabinentüre den fanatischen Tifosi gegenüber. Sogar der Präsident des FC Basel Düblin wurde von einem wegen Foul des Platzes verwiesenen Spieler sowie dessen Bruder und dem Platzwart mit Faustschlägen angegriffen. Am Bahnhof hatte sich eine grössere Menge versammelt, die es speziell auf den Schiedsrichter abgesehen hatte (aus den Basler Nachrichten).
- Aufstiegsspiel 2./ 1. Liga 1951 FC Lamone - BSC Old Boys: „auf ungenügend bewachtem Terrain und bei brodelnder Atmosphäre kam es zu einem vorzüglichen Spiel und lautete das Resultat schliesslich 0:2 für Old Boys. Dies passte dem fanatischen Publikum nicht und verärgert schlug es die Gelb-Schwarzen in die Flucht. Aber was machte es den Baslern aus, sich für einmal in der Toilette des Bahnhofs von Lugano umziehen zu müssen?“ (Clubchronik 75 Jahre Basler Sport-Club Old Boys)
1958 fand anlässlich des 10-jährigen Bestehens der US Ticinese auf dem Landhof ein 'Freundschaftscup Basel-Tessin' mit den Teilnehmern FC Basel, FC Concordia, FC Lugano und FC Chiasso statt.
US Bottecchia e US Ticinese Basilea (II), seconde fondazioni:
Entscheidungsspiele um die 4. Liga-Meisterschaft (Mai 1952):
„Eine durchwegs ausgeglichene Partie mit erfreulichem Niveau. Die viel wendigeren und schnelleren Italiener - wie könnte es auch anders sein - haben verdient gewonnen“ (US Bottecchia - SC Eisenbahner 2:1)
„Man spielte sentimentales Theater, foulte den Gegner und war dabei natürlich unschuldig, kickte das Leder weit in Out und wurde dabei unterstützt von einer wild kreischenden Italienerschar“ (US Bottecchia - SC Morgarten 0:0 - Berichte NZ 26.5.1952)
Finalspiel um den Herausforderungscup FC Allschwil (2. Liga) - US Bottecchia b (3. Liga - Collarini; Ridolfi, Massetto; Urfer, Molinario, Comment; Thangulani, Battistini, Ademo, Dellanora, Blättler) 1:1 (Dezember 1956):
„Mit Bottecchia hatte sich der Cupholder Allschwil einen schweren Herausforderer aufgeladen, mit dem er seine liebe Not hatte. Jene haben in ihren Reihen einige talentierte Spieler, und mit etwas mehr Ruhe und Kaltblütigkeit wäre der Cup in ihren Besitz übergegangen“ (NZ)
Aufstiegsspiel 3./2. Liga US Bottecchia - US Ticinese Basilea 1:3 Stadion Rankhof (23.6.1957):
„Bei diesem 'Italiener'-Match glaubte man sich oft wirklich jenseits des Gotthards zu sein. Die zirka 500 Zuschauer, meistens Ticinesi, gingen fanatisch mit. Das Spiel war hart umkämpft, blieb aber unter der starken Hand von Schiedsrichter Emmenegger stets im Rahmen des Fairplay“ (NZ)
Aufstiegsspiel 3./2. Liga US Ticinese Basilea - FC Röschenz 3:1 Stadion Rankhof (30.6.1957):
Mannschaft des Siegers: Oncelli; Rocchi, Eglin I; Rampalino, Brazzini, Eglin II; Ghezzi, Dolfini, Keller, Crociani (ex FC Nordstern), Chiandelli.
Aufstiegsspiel 3./2. Liga FC Birsfelden - US Bottecchia 3:0 forfait (1960):
Beim Stand von 2:1 zu ihren Gunsten (!) verliessen die Italo-Basler - weil sie sich vom Schiedsrichter ungerecht behandelt fühlten - aus Protest das Spielfeld und sorgten für einen bis dahin einmaligen Vorfall. Berichte darüber, dass (beleidigte) Gastarbeitermannschaften das Ende nach Verwarnungen und Platzverweisen nicht abwarteten, gibt es auch später.
„Bottecchia Basel bestätigte in zwei Punkten die Meinung, die man sich von einer Italienermannschaft macht. Eine solche Mannschaft ist kampf-, lauf- und einsatzfreudig, solange sie einem Gegner keine Goals zugestehen muss, oder sogar in Führung liegt. Gerät man aber in Rückstand, dann wirft man zu früh den Hammer weg, und alles andere ist schuld an einer Niederlage, nur nicht das eigene Nichtkönnen“ (3. Liga 1972, Basellandschaftliche Zeitung)
„Den ersten aktiven Mitgliedern aus der Lombardei und dem Piemont folgten weitere, hauptsächlich aus Venetien und Friaul, und in den 70er Jahren folgten dann Apulier, Kampanen, Calabrier und Sizilianer. Spieler aller Herkunft und Nationalität haben sich immer diesen angeschlossen - und jeder hat sich immer wohlgefühlt (...) Für die Spiele am Sonntag traf man sich an der Heuwaage, um die Transfers mit dem Bähnlein zu bewältigen, Autos gab es wenige (...) Es wäre falsch, die Siege in den verschiedenen Meisterschaften, die Play-Offs um den Aufstieg in höhere Kategorien, den Gewinn des Basler Cups und die zahlreichen Turniere in der Schweiz, Frankreich und Italien zu vergessen. Wer erinnert sich nicht an die sehr erfolgreichen Feste. Aber es gab auch schwierige Momente, die Abstiege, Probleme im Verein...“ (Jubiläumschronik US Bottecchia)
„Einst fand dieses grosse Fest fussballspielender Italiener und des Freundeskreises in einem Aussenquartier Basels statt. Seit kurzem sah man sich des riesigen Andranges wegen zur Verlegung ins Stadt-Casino veranlasst. Die ehemals kleine Jahresfeier der US Bottecchia ist zum ausgewachsenen gesellschaftlichen Anlass geworden. Künstler von Radio und Television Italiens in Anwesenheit des italienischen Konsul und des Ehrenmitglieds Joseph Ceppi sorgten jetzt wieder für ein abendfüllendes Programm“ (14. Jahresfeier der US Bottecchia, Basler Nachrichten 12.5.1965)
Die anfangs der 80er-Jahre auf dem Platz Basel führenden Bottecchia und Internazionale Basilea schlossen sich für vier Jahresfeiern zusammen, obwohl gerade unter diesen Konkurrenten die Abwerbung von Spielern zu dieser Zeit besonders gross war.
„Wir können nicht so viel Geld investieren wie andere Vereine aus unserem Heimatland, so dass wir zwangsläufig gute Spieler nicht halten können“ (US Bottecchia 1987)
„Noch von 1956 bis 1958 spielte die US Ticinese in der 2. Liga. Heute müssen sich die Südschweizer mit einem Platz in der 4. Liga zufriedengeben (...) Als beste Ausländermannschaft schwebt Jugos in der 2. Liga in akuter Abstiegsgefahr, aber auch in der 3. Liga spielen Internazionale Basilea, Rossoneri, Bottecchia und das Italiener-Team der Grasshoppers nur eine untergeordnete Rolle (...) Die fortschreitende Integration dieser Bevölkerungsteile - vor allem des Nachwuchses - in unsere Gesellschaft stellen viele Vereine vor 'Nachschubschwierigkeiten'. Die Kinder der sesshaft gewordenen Zuwanderer wachsen beinahe vollständig in die Mentalität und Sprache ihrer neuen Heimat hinein und haben in der Regel das Bedürfnis, mit ihren Schulkameraden in einem Club zu spielen. Damit fehlt den meisten der nichteinheimischen Vereine mit einer Juniorenabteilung auch der Unterbau (...)
Der 1948 [mit Hilfe des Vereins 'Pro Ticino'] wieder gegründete Tessinerverein war bald auch das Sammelbecken vieler Gastarbeiter aus Italien (...) In der Folge aber wechselten die Italiener in die vielen neu gegründeten Gastarbeitervereine (...) Ein Problem beschäftigt (nicht nur) die Tessiner besonders stark. Oftmals zieht es die jungen Aktivspieler (...) über das Wochenende in ihren Heimatkanton zurück. Der Verein kann deshalb praktisch nie zweimal hintereinander in der gleichen Formation antreten“ (Andreas Schluchter, Basler Zeitung 29.4.1981)
1973 25. Jubiläum mit grossem Unterhaltungsabend im Gundeldinger Casino u.a. unter Mitwirkung von Sängerin Nella Martinetti (Präsident O. Gobbi).
Ende der 80er Jahre wurde die erste Mannschaft des Clubs, bei dem die 'Einheimischen' nur noch bei den Senioren vertreten waren, mit ihrer umbrischen Untersektion aus der Region zwischen Florenz und Rom, die vorwiegend aus in Basel aufgewachsenen Italienern, aber auch Spaniern und Deutschschweizern bestand, zusammengelegt.
1990 musste Ticinese, das 1989 noch Regionalmeister der 4. Liga geworden war, die Mannschaft vom Spielbetrieb zurückziehen:
„An allem ist eigentlich der Gotthardtunnel schuld: seitdem es möglich ist, in zwei, drei Stunden ins Tessin zu fahren, ziehen es die Tessiner vor, am Wochenende nach Hause zu fahren“ (Präsident)
Nuove associazioni di migranti italiani:
Mit der Hochkonjunktur nahm die Zahl der Gastarbeiter immer mehr zu. In den siebziger Jahren lebten schliesslich mehr als 80'000 Italiener in der Region Basel. Ihre Anliegen im kulturellen, sozialen und seelsorgerischen Bereich ('sie stammten aus Grossfamilien und kamen in die Einsamkeit') wurden durch die Migrantenorganisationen der seit 1948 bestehenden 'Colonia libera italiana' C.L.I. als grösster Interessenverband der italienischen Emigration in der Schweiz und der 'Missione Cattolica Italiana' vertreten: die Aufgabe der Schwestern und Padres verschiedener Orden mit Tätigkeitsbereichen ab 1961 in Allschwil, Arlesheim, Birsfelden, Laufen, Liestal, Muttenz und Pratteln bestand darin, über Kinderkrippen, Kindergärten und Begegnungsstätten als sogenannte 'ritrovos' untereinander ein Netz zu spannen und Brücken zu schlagen.
1959 formierte sich die AC Virtus Liestal (C.L.I.) als erster unter eigenem Namen firmierender Fussballverein italienischer Migranten auf Baselbieter Boden.
Der gelernte Dreher A.V. (FC Liestal, AC Virtus), welcher (privilegiert) nicht wie viele Italiener direkt nach der Schule als Hilfsarbeiter in die Schweiz kam, erzählte später von seiner schwierigen Ankunft (1961). Für Italiener gab es keine Wohnungen. An seiner ersten Arbeitsstelle wurde er vom Abteilungsleiter schikaniert und man drohte ihm mit dem Rauswurf („draussen warten weitere 30 Italiener“). Aber neben dem beruflichen Wechsel fand er auch über den Fussball schnell Anschluss und baute ein tragfähiges Beziehungsnetz auf. Eine Szene blieb ihm in Erinnerung, als er nach einem Zusammenstoss mit einem jungen Schweizer als 'Sautschingg' tituliert wurde (Bericht Basellandschaftliche Zeitung).
„Die Sprecher der beiden neuen Clubs FC Iberia und FC Colonia Libera Italiana Liestal hatten mit ihrem Aufruf an die Delegierten «Helfen Sie uns, mit Euch in Kontakt zu kommen» Erfolg. Bei den Spaniern konstatierte man lediglich eine Gegenstimme, bei den Italienern eine Zustimmung mit dem Ergebnis 20:8, wobei festgehalten werden muss, dass sich zahlreiche Clubs der Stimme enthielten“ (Bericht DV Fussballverband Nordwestschweiz, NZ 14.6.1961)
„Mit dem Aufstieg von AC Virtus in die 3. Liga kam es am Samstag abend auf dem Stadion Gitterli zum ersten Stadtrivalenmatch zwischen Liestal und der hiesigen Italiener-Mannschaft. Virtus überreichte zu diesem Anlass dem FC Liestal einen Blumenstrauss und die Einladung zur Veranstaltung in der Militärhalle, die die Colonia dort organisiert hatte. Für diese nette Geste bedankten sich die Liestaler mit zwei Kantersiegen auf dem Fussballplatz, denn schon im Vorspiel besiegte Liestal II Virtus II mit 9:1. Die erste Garnitur der Italiener verlor ihren Match mit 7:1 (...) Virtus spielte, wie es Italiener tun: man rannte jedem Ball nach und verlor dadurch das Teamwork vollständig“ (Basellandschaftliche Zeitung 15.9.1976)
„Wie man es von Südländern gewohnt ist, rennen sie so lange dem Ball nach, bis die Kondition nachlässt. Dann hat der Gegner leichtes Spiel, und die Höhe des Resultates ist dann nur noch von sekundärer Bedeutung“ (AC Virtus Liestal - FC Liestal 0:6, 21.3.1977 Basellandschaftliche Zeitung)
In Lausen, wo viele Italiener im Tonwerk arbeiteten, lief der organisierte Fussball zuerst unter ihrer Flagge, dem sich erst später auch die Einheimischen assoziierten (FC Lausen 72 mit Rosario Grassa und Vittorio Sarro), weil die AC Rossoneri kein Interesse an einer neugegründeten Juniorenmannschaft bekundet hatte. An der Generalversammlung 1971 erteilte sie die Freigabe der Schweizer Spieler (Chronik FC Lausen).
Untersektionen wurde bei den Fussballclubs von Aesch ('Arcobaleno' 1959 - „mit dem Ziel, der italienischen Gemeinschaft die Möglichkeit zu einem engeren Kontakt mit der Bevölkerung zu geben“), Sissach (1960), Gelterkinden, Rheinfelden (1961), Pratteln (wo 1974 über zweieinhalbtausend und besonders viele Italiener ansässig waren: später war in den Verein auch je eine unabhängige Mannschaft mit Spaniern und Portugiesen integriert, die wie die Italiener über eigene Vorstände verfügten), Stein (1962), Dornach (1963 - Vertrag mit der Italiener-Sektion 'Tricolore') oder Oberdorf (1964 - 'Circolo Italiano', definitive Angliederung 1970) willkommen geheissen, auch wenn diese Ehen häufig von unüberbrückbaren Differenzen und enttäuschten Erwartungen geprägt waren.
„Am 11.11.1962 war es dann soweit: der FC Stein und die von Anfang an existierende Sektion der CLI bestritten ihre ersten Heimspiele“ (Zitat Fritz Käser jun.)
„Der Gegner, Pratteln IIb, war die Italienermannschaft des FC Pratteln, die spieltechnisch in der 3. Liga knapp mitzuhalten vermag. Erfreulich an diesem Team war, dass sich die Spieler sportlich den Entscheidungen des Schiedsrichters unterzogen, obwohl sie bald einsehen mussten, dass gegen Liestal keine Punkte zu holen waren“ (Basellandschaftliche Zeitung 27.3.1973)
„Abschliessend möchte ich noch festhalten, dass Rossoneri eine sehr fair spielende Italienermannschaft war, einzig das akustische Spektakel im und ums Spielfeld ging einem etwas an die Nerven“ (Bubendorf-News 11.9.1979)
„'Mini-Napoli', schwärmte der AC Rossoneri am Sonntag nach seinem 1:0-Sieg im Viertliga-Spitzenkampf gegen den SV Sissach. Gemeint war damit nicht der gezeigte Fussball auf gefrorenem Terrain, sondern das Publikum, das sich nicht nur mit Pauken und Trompeten, sondern mit Knallraketen und Fahnen zu erwärmen versuchte und somit für Stimmung in der Lausner Sonntagsruhe sorgte“ (Basellandschaftliche Zeitung 7.12.1989)
Von der nicht immer erfolgreichen Vermittlungsarbeit berichtet die Chronik des FC Frenkendorf aus der Saison 1961/62: „die Mission der italienischen Kolonie gelangte mit dem Gesuch an den Gemeinderat, den Sportplatz regelmässig benutzen zu dürfen. Nach Rücksprache mit dem Vorstand wurde das Gesuch abgelehnt“
'Im Bestreben, die Gastarbeitervereine auch in ihrer inneren Struktur zu stärken', wurde 1966 sowohl vom Verband wie auch dem Konsulat auch in Bubendorf die Gründung eines Italiener Clubs abgelehnt, der sich vornehmlich aus Mitgliedern von Virtus Liestal und Rossoneri Lausen hätte zusammensetzten sollen.
Eine überdurchschnittlich grosse Italienerkolonie war in der Stadt Laufenburg, wo der Bestand an Ausländern weit über dem Landesdurchschnitt lag, zuhause. Sie stammten fast alle aus der sizilianischen Ortschaft Leonforte aus der Provinz Enna. Auch die Laufenburger Italiener besassen mit dem Fussballclub Azzurri ab 1968 eine angegliederte Mannschaft, auf die sie besonders stolz waren („die Italiener aus Laufenburg spielen manchmal gut, dann wieder miserabel, d.h. nach Lust und Laune“)
„Rheinfelden b ist eine Italienermannschaft. Der Kenner weiss damit schon alles. Jeder der Spieler hat irgendein berühmtes Idol, sei es ein Gigi Riva, Mazzola oder Facchetti und ahmt diesen mit artistischen Einlagen nach. Handkerum schlagen die Spieler Löcher in die Luft und düpieren sich selbst. Ihr grösstes Übel ist aber, dass sie das Maul nicht halten können. Jeder Schiedsrichterentscheid ist für die Südländer das grösste Unrecht auf der Welt. So kam es, dass der Ref wegen Reklamierens und Gestikulierens vier Verwarnungen aussprechen musste. Im Wiederholungsfall bedeutet dies Ausschluss und so mussten deswegen drei Mann in die Kabine marschieren. Als am Schluss die Niederlage unabwendbar wurde, liefen zwei weitere Spieler freiwillig vom Platz. So musste der Schiedsrichter die Partie wenige Augenblicke vor Schluss abbrechen, weil nicht mehr 7 Mann beim Gegner auf dem Spielfeld waren“ (3. Liga-Spielbericht, Basellandschaftliche Zeitung 30.11.1971)
1971 bis 1990 bestand dank italienischer Gastarbeiter im Viaduktdorf Rümlingen ein Fussballclub, und die kleine Gemeinde im Homburgertal spielte zwei Saisons in der 3. Liga. Unterstützt wurde die Gründung vom örtlichen Holzbauunternehmer Erhard Leuthardt („wir erachten es als angezeigt, dass sich unsere Mitarbeiter auf diese Art sportlich betätigen“). Eine 'Cantina', eine Baracke, diente als Garderobe, wobei die Gegner es oft vorzogen, diese erst gar nicht zu benutzen. Dem Gründungsvorstand gehörte auch der bekannte Springreiter Hansueli Sprunger an (aus der Volksstimme 24.8.2023, Jürg Gohl). In einem Spielbericht des FC Bubendorf von 1988 wurde die Fairness der Türken im Team herausgestrichen, aber zu Spielabbrüchen kam es ebenfalls.
Der FC Laufen III schaffte 1974 den Eintritt in die 3. Liga. Die dritte Garnitur stelle in erster Linie eine schöne und ideelle Freizeitbeschäftigung für die vielen ausländischen Gastarbeiter und Freunde, die einfach zum Laufener Bild gehörten und in den Firmen und Betrieben wertvolle Tätigkeiten leisten würden, dar, hiess es dazu. Der Club verstehe sich als Integrationschance, und der sportliche Erfolg käme erst an zweiter Stelle (Jubiläumschronik).
Calcio societario:
Corso-Cupfinal 1951 Sandoz - Schindler Pratteln (Serie A) als erster Hinweis auf eine ausschliesslich aus Italienern bestehende, ambitionierte Firmenmannschaft (Mazzoleni; Spinelli, Sironi; Esposti - FC Concordia, Rollo, Manni; Magni, Pina, Radaelli, Tusoldi, Lini): die Leute aus den Schindlerwerken glänzten mit ihrer enormen Geschwindigkeit, was wohl auf die Südländer, die in ihren Reihen mittun, zurückzuführen sei, hiess es über den Regionalmeister 1952 anlässlich der Firmensporttage.
„Es ist bestimmt begrüssenswert, wenn man den Gastarbeitern Gelegenheit bietet, im Firmensport ihre Freizeit sinnvoll mit Sport auszufüllen. Doch sollten bei Teams mit mehreren Südländern die Verantwortlichen ein besonderes Auge auf die hitzigen Gemüter werfen. Es darf einfach nicht sein, dass Spieler, welche sich benachteiligt fühlen, nach Spielschluss den Schiedsrichter tätlich bedrohen. So geschehen beim Meisterschaftsspiel der Serie C zwischen Züblin und Meidinger. Der Schiedsrichter musste nach Spielschluss durch den Spielführer von Meidinger Polizeischutz anfordern, um heil vom Platz zu kommen“ (BN 18.10.1972)
Calcio operaio:
In der Stadt förderte die Haltung des SATUS die Aufnahme:
„Die aus italienisch-sprechenden Spielern zusammengesetzte Mannschaft US Juventina-Allschwil führte sich schon bei ihrem ersten Spiel in der Serie B auf der Friedmatt gegen Fortuna II mit einem 12:1-Kantersieg gut ein“ (NZ 29.8.1961)
Der mit den Gebrüdern Martin (Vereinigte Sportfreunde) und Hügi (Fortuna) verstärkte AFC Sparta hatte bereits im Juni 1947 gegen die Gewerkschaftsmannschaft der Mailänder Kunstseidefabrik Snia Viscosa vor 1500 Zuschauern auf dem Landhof und 1952 gegen die Elf von Cattolica, die eine der fairsten, bis dahin in Basel gastierenden ausländischen Mannschaften gewesen sein soll, gute Erfahrungen gemacht.
Satus-Stadtmannschaft - Italienische Fremdarbeitermannschaft 2:3 (1.5.1962):
Im Rahmen der traditionellen 1. Mai-Veranstaltung auf dem Sportplatz Friedmatt an der Flughafenstrasse „bei einem aussergewöhnlich guten Zuschaueraufmarsch, worunter sehr viele italienische Fremdarbeiter, die ihre Fussballmannschaft stimmlich unterstützten“ (NZ) „Die Gäste aus Italien besassen mehr Temperament und hatten spielerisch und läuferisch ein kleines Plus“ (BN)
Nach der Hochkunjunktur und der anschliessenden Rezession Mitte der 70er-Jahre, die wegen der fehlenden Beschäftigungsmöglichkeiten viele Gastarbeiter in ihre Heimat zurückkehren liess, litten viele Ausländerclubs an Spielermangel.
Bereits in den 70er Jahren meldeten Basler Satus-Vereine, welche alle über keinen Nachwuchs verfügten, ernsthafte Probleme, die sie vorerst über den Zuzug von Italienern und ihren Kindern beheben konnten. Die Gastarbeiter nahmen im städtischen Fussball überhaupt eine immer grössere und bald dominierende Rolle ein.
Brutte notizie da Basilea:
Das Wohlwollen über die Einbindung immer neuer Gruppierungen, die sich meistens nach den Vorbildern ihrer Herkunftsorte nannten, wurde getrübt, denn es kam durch ihr nicht immer mustergültiges Verhalten zu hier nicht gekannten Spielabbrüchen und Tumulten. Inwiefern der 1965 anlässlich einer DV diskutierte Antrag, die in Verruf geratenen Ausländervereine in einer separaten Gruppe zusammenzufassen, politisch motiviert oder Ausdruck eines als Unbehagen empfundenen tatsächlichen Problems war, wollte trotz vorhandener Statistik auch der Verband nicht beantworten. Der Antrag wurde zurückgezogen, aber 1967 wegen anhaltender Disziplinlosigkeit („wiederholte Tätlichkeiten und Raufereien“) der 'von der spanischen Kolonie Basels' 1961 gegründete FC Iberia Augst suspendiert.
FC Arbeitsamt - FC Fremdenpolizei 0:1 (September 1963):
„Da auch in Basel viele ausländische Arbeitskräfte wohnen und arbeiten, welche alle eine Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung brauchen, respektive haben sollten, herrscht auf der Fremdenpolizei sowie auf dem Arbeitsamt 'Hochbetrieb'. Jeden Tag haben die beiden Abteilungen miteinander geschäftlich zu tun. Vergangenen Freitag lernten sie sich nun auf dem Buschwylerhof in sportlicher Weise kennen. Regierungsrat Wyss sorgte durch eine famose Schiedsrichterleistung, dass alles im Rahmen blieb (...) René Bader war der Schütze des siegbringenden Treffers“ (BN 30.9.1963)
Die italienischen Behörden bedankten sich im Spätherbst 1965 ausdrücklich für die positiv verlaufenen Verhandlungen zwischen den Spitzen des Fussballverbandes Nordwestschweiz und dem italienischen Konsulat in Basel, Gastarbeitermannschaften am Meisterschaftsbetrieb teilnehmen zu lassen. In einem Appell hatte Vizekonsul Maurizio Moreno seine Landsleute allerdings erinnert, Temperament und Leidenschaft sowohl als Spieler wie auch als Zuschauer zu zügeln und keinen Anlass für Klagen mehr zu geben.
„Alle die vielen Verantwortlichen in den Clubs wissen genau, wie schwer es in der Regel ist, das Temperament der vielfach primitiven italienischen Spieler und Zuschauer im Zügel zu halten, doch sie glauben, mit ihrer Arbeit in den Vereinen etwas zur Milderung der seelischen Not der hier arbeitenden jungen Italiener beizutragen“ (Pietro Vignutelli, Sekretär US Bottecchia - Protokoll der 26. ordentlichen Delegiertenversammlung des Regionalverbandes Nordwestschweiz 1965)
„Unerfreuliches spielte sich beim 5. Liga-Final ab, musste dieser doch beim Stand von 2:0 für die Grasshoppers gegen Juventus wegen einer Tätlichkeit am Schiedsrichter abgebrochen werden“ (BN 10.6.1975)
Fehlbare Spieler wurden von der Strafkommission für 18 Monate bis auf unbestimmte Zeit suspendiert.
„In der Gruppe 2 der 3. Liga gab es einen unliebsamen Zwischenfall, denn in Oberdorf musste die Partie der Baselbieter gegen Juventus Basilea b nach einer Schlägerei abgebrochen werden. Leider ist gerade Juventus durch solche betrüblichen Angelegenheiten in den letzten Jahren bereits mehrmals negativ aufgefallen“ (BN 11.11.1975). „Die zweite Herausstellung eines Juventusspielers, der mit einer Boxeinlage aufwartete, erhitzte die Gemüter derart, dass es zu einer allgemeinen Schlägerei auf dem Platz und am Rande des Spielfelds kam“ (Basellandschaftliche Zeitung 12.11.1975)
Nachdem gegen Concordia II auf den Sportanlagen St. Jakob auch noch gleich der vom Nebenplatz zu Hilfe eilende Schiedsrichter von Anhängern ('mit teilweise schweren Verletzungen') spitalreif geschlagen wurde, verfiel die Mannschaft dem Abstieg und wurde vom Verband mit einem Bussgeld von 2800 Franken belegt, aber im April 1980 im Heimspiel gegen Bubendorf oder 1996 in Laufen musste die Polizei gegen Juventus erneut einschreiten - die (subjektiven) Zeitzeugnisse sind ungefiltert wiedergegeben und auf eine Einordnung ex post wird verzichtet: 1970, 1974 und 1977 gelangten drei sogenannte Überfremdungsinitiativen zur Abstimmung.
„Einen schlechten Eindruck hinterliessen die Einheimischen, welche sich mit so groben Mitteln einsetzten, dass den Oberdörfern schliesslich heile Knochen wichtiger waren als zwei Punkte (...) Es stellt dem Unparteiischen ein schlechtes Zeugnis aus, wenn er lakonisch bemerkt: «Dies sei eben die Spielweise der Italiener!» Unserer Meinung haben Mannschaften, die meinen, auf dem Spielfeld eine Schlacht austragen zu müssen (...) nichts in der Meisterschaft zu suchen“ (3. Liga AS Timau - FC Oberdorf 2:0, Basellandschaftliche Zeitung 27.9.1973)
FC Juventus Basilea:
„So viele Zuschauer (mehr als 500) und eine solche Lärmkulisse sahen wir seit dem Aufstiegsspiel gegen Delsberg vor einem halben Jahr auf der Schorenmatte nicht mehr! Und dazu ein Spiel, wie man es in der 2. Liga selten zu sehen bekommt - kämpferisch und spannend (...) Wenn man bedenkt, dass die Zuschauer zu zwei Dritteln aus Italiener bestanden, kann man sich die Stimmung vorstellen“ (Basler Nachrichten 17.11.1969 zum 2. Liga-Spitzenkampf SC Kleinhüningen - FC Juventus Basilea: Rambaldi; Gomez, V. Vidali; Ochoantesana, Tonon, Della Valentina; Pasgual, Matassa, Zamolo, M. Vidali, Marabese)
„Nichts gegen italienischen Fussball und italienische Mannschaften in den unteren Ligen. Aber was der fanatische und hysterische Anhang von Juventus am Sonntagmorgen auf dem Buschwylerhof aufführte, gehört eindeutig in das böse Kapitel Widerlichkeiten. Man kann nun einfach nicht jeden Schiedsrichterentscheid und jedes kleine Vorkommnis auf dem Platz mit einer konstruktiven Missfallensäusserung kommentieren“ (Basler Nachrichten 2.3.1970 zum 2. Liga-Spiel FC Black Stars - FC Juventus Basilea)
„Die Spielweise von Juventus trug die bekannten Züge. Kein Ball wurde verloren gegeben, letzter Einsatz im Zweikampf gezeigt und jeder Ball vor allem möglichst weit nach vorne geschlagen„ (3. Liga FC Juventus a - FC Gelterkinden a, Basellandschaftliche Zeitung 1975)
Der FC Juventus Basilea gewann in der Saison 1968/69 für seine Gesamtleistung den Reini Erbe-Cup.
Juventus konnte sich 1971 vor dem dem Inter-Club Basilea (96) und Bottecchia (95) und noch vor dem FC Basel auf die grösste Anzahl erwachsener Spieler (162) stützen (dagegen brachten es AC Rossoneri Lausen, AC Virtus Liestal und Aurora Grellingen nur auf einen Bestand von 48, 46, bzw. 20 Spielern).
Im Juni 1982 veranstaltete der FC Juventus Basilea, hinter dem 'Basels fussballbegeistertster Schuhmacher' Domenico Fazzari stand, anlässlich seines 20jährigen Bestehens im Stadion St. Jakob ein Jubiläumsspiel zwischen einer kombinierten Basler Mannschaft (Basel United) und dem Turiner Nachwuchs (Primavera).
1988 ging Juventus-Reggina mit dem FC Breite, bzw. der fusionierten, seit der Saison 1974/75 im autonomen Verhältnis eine Untersektion bildende UPR, eine Gruppierung mit 150 Junioren ein. Der noch zu 80 Prozent aus Italienern bestehende Club, der zu dieser Zeit neben der US Olympia als einziger der Basler Ausländervereine über eine Nachwuchsabteilung verfügte, umfasste jeweils zwei Aktivmannschaften in der vierten und in der fünften Liga, deren Untersektionen aus Südamerikanern und Portugiesen weitgehend autonom waren.
Bei der offiziellen Gründungsfeier des Juventus Fanclub Basilea konnte 1989 der Internationale Luigi De Agostini begrüsst werden. Im seit 1986 bestehenden Vereinslokal an der Kleinhüninger-Anlage 7 verfügten die Italo-Basler über eine Grossleinwand, um auf den italienischen Pay-TV-Sendern Stream und Tele+ jede Partie sehen zu können („Sonntag für Sonntag steigt so die Calcio-Party von Kleinhüningen“ - 2003).
[„Der Präsident musste ein Machtwort sprechen. «Die Wände des Clublokals der US Bottecchia werden nur mit Wimpeln verziert, die nichts mit den Teams der italienischen Serie A zu tun haben (...) Der eine ist Juve-Fan, der andere ist für Milan und der Dritte will, dass man die Inter-Utensilien aufhängt, wir aber wollen neutral sein, dann gibt es keine Diskussionen». Es reicht schon, wenn sich seine Gäste beim sonntäglichen Besuch des Clubhauses, nicht einig darüber seien, welches Serie A-Spiel sie am TV sehen wollen“ (Basler Zeitung 2006)]
Einen FC Juventus gab es auch in Binningen (Auflösung 2004), der ab 1982 als Untersektion den Vereinigten Sportfreunden (Horburg) angegliedert war.
Ticinese (1957 - mit den früheren Nordstern-Spielern Crociani, Wirz, Bürgi und Chenaux), Juventus Basilea (1969) sowie Internazionale Basilea 1978 und 1992 („weil viele Spieler jetzt in Italien in den Ferien weilen, ist erst am 4. August Trainingsbeginn“) unternahmen nebst Jugos (die schnellen drei Wiederabstiege sollen auch mit den vielen Ferienabsenzen zu tun gehabt haben) einen Abstecher in die vierthöchste Liga.
Auf die Spielzeit 1967/68 war vom Inter-Club Basilea und den nach den Trikotfarben der AC Milan benannten Rossoneri aus Lausen erstmals Nachwuchs gemeldet worden. Auch bei Bottecchia besann man sich auf seine Basis. Gerade Sport galt als Möglichkeit, den sich im Leben der Emigration verschärfenden Jugendnöten wie reduzierten Berufsbildungschancen und der Identitätssuche zwischen verschiedenen Sprachen und Kulturen entgegenzuwirken:
„Viele Junioren konnten Gutscheine und Geschenke entgegennehmen und es fiel auf, dass besonders italienischen und spanischen Junioren diese Preise zuerkannt wurden“ (21. Junioren- und Elternnachmittag des FC Black Stars im Spalencasino, NZ 8.2.1972)
_________________________________________________________
Coppa delle Alpi:
16.6.1963 FC Basel - Juventus Football Club 1:5 vor 22000 Zuschauern:
„Das Treffen gegen die berühmte Juventus verfehlte seine Anziehungskraft nicht. In hellen Scharen strömten die Gastarbeiter aus der näheren und weiten Ungebung ins Fussballstadion. Als die beiden Teams gemeinsam auf den Rasen liefen, klappte der Ordnungsdienst nicht. Dutzende von übermütigen Tifosi übersprangen die Brustwehr, um mit Transparenten in den schwarz/weissen Klubfarben ihre Lieblinge zu begrüssen. Erst nach einer halben Stunde erschien die Polizei mit Schäferhunden und riegelte das Spielfeld vor weiteren Invasionen ab“ (NZ 17.6.1963)
An drei Spieltagen in nur einer Woche gastierten 1966 Spal Ferrara, Catania Calcio, S.S.C. Napoli und der Juventus FC im Joggeli):
„Der Alpencup, dessen Spiele in unserem Lande zwischen dem 4. und 15. Juni 1966 seine sechste Auflage erleben wird, gehört zu den beliebtesten der internationalen Wettbewerbe (...) weil er den Fussballanhängern da wie dort die Gelegenheit vermittelt, Elitefussballer aus der Heimat zu betrachten und zu beklatschen. Dies werden vor allem die Tausenden von italienischen Gastarbeitern freudig begrüssen, die sich seit Jahren in der Schweiz betätigen und bewähren“ (Tip-Sportmagazin 31.5.1966)
2.10.1968 FC Basel - FC Bologna 1:2 (Messestädtecup 1968/69):
„Beim Spiel wurde die Wichtigkeit des Beschlusses der Nationalliga erkannt, der sofort - spätestens vom 1. Juli 1969 an - sämtlichen von Nationalligamannschaften für ihre Heimspiele benützten Sportanlagen die Abgabe von Getränken in Glasgefässen verbietet [auch das Mitbringen von Wurfkörpern aller Art wurde unter Strafe ausdrücklich untersagt]. Auch das Mitbringen gefüllter oder leerer Glasgefässe (...) wird ausdrücklich verboten. Was sich im Stadion St. Jakob am Mittwochabend abspielte, war eine traurige ...himmeltraurige Angelegenheit (...) Was da alles an Bierflaschen, Scherben, Papier und Esswaren herumlag, spottet jeglicher Beschreibung“ (BN 4.10.1968)
27.6.1969 FC Basel - FC Bologna 3:1:
„Rund 21000 Zuschauer, vor allem italienische Gastarbeiter, waren erschienen, um den Final des diesjährigen Alpencup mitzuerleben“ (Tip-Sportmagazin 1.7.1969). Im Vorfeld war eine Ermahnung des italienischen Konsuls Trenea an seine Landsleute ergangen, nachdem es beim Spiel Basel gegen Napoli trotz Hundeführern zu unschönen Szenen gekommen war. Ein besonderes Andenken trug derjenige Matchbesucher davon, der gebissen wurde und seine Hosen verlor, worauf ein Hagel von Büchsen und Flaschen niederging und man gegen Bologna auf den Wachthund verzichtete.
22.6.1971 FC Basel - FC Varese 0:1:
„Schlägereien auf den Zuschauerrampen, noch und noch Flaschenwürfe auf das Terrain, sorgten für die in diesen Alpencup-Treffen üblichen widerlichen Begleiterscheinungen“ (BN 23.6.1971)
25.6.1971 FC Basel - SS Lazio Roma 1:3:
„Zum Glück haben die Italiener gewonnen, damit die Zuschauer in der Siegesfreude vergassen, weiter Blödsinn zu treiben (...) Wenn Basel weiterhin in diesem Wettbewerb mitmachen will, muss es sich schleunigst entschliessen, im St. Jakob Eisenhäge und Stacheldraht zu installieren, damit auch bei Italienerspielen auf dem Spielfeld Ordnung herrscht“ (Basellandschaftliche Zeitung 28.6.1971)
__________________________________________________________
Mit der Aufnahme von Hungaria 1959 und Verselbstständigung von Español, Jugos und Anadolu („durch die vorbildliche Haltung der Spanier und Türken, denen ACV, St. Clara bzw. Old Boys Gelegenheit zu sportlicher Entfaltung boten“ - Zitat DV) wurde das Spektrum breiter.
España:
Weil der Verband keine wahllosen Clubgründungen zuliess, bildeten bei den Spaniern und Türken die besten Spieler formell eine Einheit, aber blieben gemäss ihrer nationalen Differenzen auf verschiedene Mannschaften verteilt.
1987 fasste Español entgegen der regionalen Gliederung für den angestrebten Aufstieg Andalusier, Galizier, Katalanen und Basken in einer Mannschaft zusammen, aber befand das Experiment später selber als gescheitert.
1990 trainierten und spielten unter dem Dach Español auf den Sportanlagen St. Jakob fünf autarke, voneinander unabhängige Mannschaften mit jeweils eigenem Präsidenten und eigenen Strukturen in der 4. Liga, die nur die Administration (mit dem Verband oder dem Schiedsrichterwesen) gemeinsam koordinierten: Español A 1963 (der ürsprüngliche Verein), Español B 1975 (intern Pontevedra nach einer Stadt in Galizien), Español C 1978 (La Coruña), Español D 1979 (Galizier aus Rias Baixas) und Español E 1985 (Águilas, einer Stadt in der südspanischen autonomen Region Murcia). Der Sekretär umriss das Freizeitangebot folgendermassen: „der Fussballalltag einer Ausländermannschaft unterscheidet sich stark gegenüber den Schweizer Mannschaften. Fussball ist da nicht nur Hobby, sondern wichtiges Bindeglied in unserem sozialen Umfeld. Unser Vereinsrestaurant (...) ist auch ein Ort der Begegnung. Da werden Feste gefeiert und auf Bestellung ist auch eine Paella zu bekommen“
Magyarország:
„Die Erwähnung des Zusammenschlusses fussballspielender Ungarn im FC Hungaria zeitigte etwas Wallung in der Diskussion, wobei sich die Ansicht durchsetzte, den Ungarn zu empfehlen, einem hiesigen Verein beizutreten, wie dies auch in den anderen Regionen (Zürich und Bern) des SFV möglich war“
„Da die Spielbewilligung auch aufrechterhalten bleibt, falls kein Anschluss zustande kommt, und da man diese Sportler nicht 'Offside' stellen soll, waren die Gegenargumente nicht nur zwecklos, sondern keinesfalls begründet und recht unfreundlich. Erfreulich war deshalb die Geste der US Ticinese (...), das Team des FC Hungaria in ihren Meisterschaftsbetrieb aufzunehmen“ (Berichte DV Fussballverband Nordwestschweiz - NZ und BN 28.7.1958)
4. Liga-Regionalmeister 1958/59:
„Bleiben die Ungarn in ihrer jetzigen Formation zusammen, so werden wir die Magyaren nächstes Jahr bei den Finalspielen um den Aufstieg in die 2. Liga finden. Fussballerisch gesehen repräsentieren die Söhne aus der Puszta heute schon 2. Liga-Standard“ (NZ 22.6.1959)
Während der Revolution verliessen 220000 Ungaren ihre Heimat, viele kamen auch in die Schweiz. Rund 1200 verschlug es während der ersten Welle in die Region Basel. Schon in den Lagern fing man an, Fussball zu spielen. Besondere Aufmerksamkeit erwarb die Lagermannschaft von Liestal, weil sie trotz schlechter physischer und psychischer Verfassung ein 4:4 gegen den FCL erreichte. Nach der Eingliederung in den normalen Lebensprozess kam es in den grösseren Schweizer Städten zur Gründung ungarischer Fussballclubs, so auch der FC Hungaria Basel. Ziel war die Überwindung von Übergangsschwierigkeiten für die ungarische Jugend, sportlichen und freundschaftlichen Kontakt mit Schweizern zu finden und so die Assimilierung zu erleichtern. Ein Einladungsspiel gegen italienische Halbprofis der Liga C, das zufriedenstellend verlief, ermunterte dazu, 1958 Antrag auf Aufnahme in den Fussballverband zu stellen. Gleich in der ersten Saison wurde der Aufstieg in die 3. Liga realisiert (Bericht Andràs Kerekes). Erhalten wurde der Verein durch Mitgliederbeiträge, persönliche Spenden und durch Einnahmen bei Veranstaltungen wie einem Tanzball.
Auch Gastarbeiter aus Jugoslawien hatten bis zur Gründung des FC Jugos vor allem beim FC Hungaria Unterschlupf gesucht (Zitat Daniel Schaub - 'Fussball NWS').
Unter seinem neuen ungarischen Trainer Nandor Cserna stieg der SV Muttenz 1972 wieder in die 2. Liga auf.
Der 1965 nach dem Einmarsch der Russen in die Schweiz geflüchtete Ungare Laszlo Segesdi begründete von 1962 bis 1973 als Juniorentrainer beim FC Nordstern eine goldene Ära und zeichnete auch beim SC Kleinhüningen, dem BSC Old Boys und in Reinach verantwortlich.
„Das grosse Problem des SC Hungaria stellt der Mangel an Nachwuchsspielern dar. Die vollständig assimilierten Ungaren der zweiten Generation ziehen es in der Regel vor, mit ihren Freunden zusammen in einem Schweizer Verein zu spielen, so dass das Durschnittsalter der Fussballer des SC Hungaria ohne die notwendige Blutauffrischung sukzessive ansteigt. Als 1974 die praktisch unveränderte Mannschaft des Gründungsjahres in die vierte Liga absteigen sollte, entschied sich der SC Hungaria, bei den Senioren weiterzuspielen (...) Da das Durchschnittsalter der Spieler mittlerweile bereits 42 Jahre beträgt, wird der SC Hungaria schon bald bei den Veteranen antreten“ (BaZ 18.5.1983)
Das Vereinsleben diente in späteren Jahren vor allem dazu, die Muttersprache zu pflegen (Zitat Präsident Zoltan Soos, 1995). Das Clublokal befand sich ab 1987 am Rande des Gundeldingerquartiers.
_____________________________________________________________
Il calcio come promozione sociale:
Stefano Ceccaronis (FC Basel 1980 bis 1986) Mutter machte sich für die Gleichberechtigung der ausländischen Kinder in der Schule stark. Die Familie war aus der Emilia-Romagna ins Iselin-Quartier gezogen. Ab 1987 stieg sein jüngerer Bruder Massimo zum Publikumsliebling auf.
1985 wurde beim FCB der spanischstämmige Pratteler Enrique Mata (Neuchâtel Xamax) zum Stammspieler. Seinen ersten Profivertrag hatte er beim damaligen A-Club FC Nordstern unterschrieben.
Vito Gottardi (FC Basel 1989 bis 1992) fand nach dreijähriger Pause über die italienische Sektion des SC Dornach 'CS Tricolore' in den Fussball zurück.
Der Aescher Erminio Piserchia („dessen Eltern in die Schweiz gekommen waren, um zu arbeiten und nicht gegen den Fussball waren, aber diesen auch nicht unterstützten“ - Edgar Hänggi, bz Basel 29.4.2020), stiess über den damaligen Erstligisten Concordia 1983 zu GC und spielte in St. Gallen und für Lugano. Aus der Nachwuchsabteilung von Aesch stammte auch der 'Sizilianer' Gaetano Giallanza (FC Aesch, FC Arlesheim, FC Aesch, BSC Old Boys, FC Basel, Servette FC, BSC Young Boys, FC Sion, FC Basel), der eine internationale Karriere anstrebte.
Samuele Campo (FC Lausanne-Sport, FC Luzern) wurde als Sechsjähriger bei einem Hallenturnier in Kleinhüningen entdeckt. Auch Marco Aratore (FC Thun, FC Aarau, FC St. Gallen) durchlief sämtliche Stufen beim FC Basel.
„Cambrio, Paoletta, Quaranta, Chiarelli, Salzillo . so könnte ein Teil der Mannschaftsaufstellung eines italienischen Teams lauten. Doch weit gefehlt - das sind einige der Spielernamen des Erstligisten Old Boys. Die meisten dieser Fussballer sind Schweizer oder spielen zumindest seit Jahren in der Nordwestschweiz, so dass man sich auch auf dem Platz in baseldeutscher Mundart verständigt“ (Andreas Schluchter BaZ 16.4.1984, Spielbericht zum 1. Liga-Spitzenspiel FC Concordia vs. BSC Old Boys)
„Cesare Cosenza [fünf Nationalliga A-Spiele für den FC Basel in der Saison 1982/83], Cuno Mattioli [ein Tessinergeschlecht], Stefan Donelli, Germano Fanciulli, Carmelo Magro: was sich auf den ersten Blick hin wie die Angestelltenkartei einer Pizzeria ausnimmt, ist in Tat und Wahrheit ein Auszug der Kaderliste des Nationalliga-B-Neulings Old Boys Basel. Und weitere Namen, die Assoziationen von heisser Sonne, überfüllten Stränden und kühlen Gelati hervorrufen, liessen sich anfügen (...) Stefan Donellis Urgrossvater war schon Schweizer, einzige Erinnerung an die Vergangenheit im Süden ist der wohlklingende Familienname. «Kein Wort Italienisch spreche ich. Es ist eine Schande!» (...) Grossgeworden bei OB ist er zusammen mit Germano Fanciulli und Carmelo Magro, den einzigen 'echten' Italienern. Nur: auch sie sind in Basel aufgewachsen und kennen Italien bloss von den Ferien her“ (Thomas Bürgi, Basler Zeitung 5.8.1987)
___________________________________________________________
AS Timau (I):
„In der Serie B hat der Satus-Neuling AS Timau im ersten Anlauf reüssiert und steigt in der kommenden Saison in die Promotion auf, wobei gerade das faire und korrekte Verhalten dieser Gastarbeitermannschaft diesen Erfolg besonders sympathisch macht“ (Basler Nachrichten 25.5.1966)
Promotions-Cupfinal 1967 AS Timau - SC Baudepartement II 3:1 „vor einer stimmungsvollen Kulisse - etwa 300 Anhänger von Timau waren erschienen“ (BN)
„Timau ist eine sympathische Italienermannschaft aus Basel, der bei einem frühen Torerfolg alles läuft und die nur schwer zu bezwingen ist. Geraten die Italiener in Rückstand, geben sie meist bald auf und sind leicht zu besiegen“ (Spielbericht 1970)
„Dass auch in der vierten Liga akzeptabler Fussball gespielt werden kann, bewiesen am Sonntag vormittag die beiden Spitzenmannschaften Old Boys II und Timau. 300 Zuschauer, meist Anhänger der AS Timau, hatten den Weg auf die Schützenmatte gefunden und damit mehr als zu jedem Zweitliga-Spiel an diesem Wochenende (...)
Während in der vierten Liga das Team der AS Timau auch 'inoffiziell' diesen Namen trägt, spielen in der fünften Liga zwei selbständige Untersektionen, die sich US Napoli und AS Molisana nennen. Offiziell aber treten zu den Wettspielen alle drei Teams unter der Bezeichnung Timau an, dem Namen eines Dorfes in der norditalienischen Region Friaul. Sogenannte Untersektionen sind bei den in der Nordwestschweiz spielenden italienischen Vereinen keine Seltenheit. Oftmals wechselt gleich eine ganze Untersektion den Club. So stiessen vor knapp drei Jahren grosse Teile der Untersektion 'Associazione Regionale Calabro Emigrati' von Juventus Basilea zur AS Timau (...) Ein Club - drei Mannschaften - drei Vorstände und drei verschiedene Dresses“ (Andreas Schluchter, BaZ 4.5. und 7.5.1984)
„«Die AS Timau ist von Spielern gegründet worden, die aus dem Dorf Timau stammten», erklärt der Präsident Angelo Nocera. Die Bindung an das Dorf Timau ist mittlerweile aufgehoben. «Von dort ist nur noch ein Vorstandsmitglied», führt Nocera an, selbst gebürtiger Kalabreser (...) Die Erfolge des kleinen Vereins mit 80 Aktivmitgliedern erstaunen. Timau besitzt keine Juniorenabteilung. Und das Durchschnittsalter des Aufsteigers in die dritte Liga lag letzte Saison über 30 Jahren“ (Martin Pütter, BaZ Oktober 1987)
1988 stammte in den vier Mannschaften kein einziger Spieler mehr aus dem kleinen Dorf der Provinz Udine.
„Der Fussball aus Italien ist für viele überhaupt das stärkste Bindeglied zur alten Heimat. Die meisten der 20-30jährigen Fussballer von Timau b (US Napoli) und Juventus sind in der Schweiz geboren und sprechen ebensogut Schweizer Mundart wie Italienisch. Punkto Fussball aber, da sind sie durch und durch Italiener geblieben. Da interessieren die Resultate von Milan, Inter, Roma oder eben Napoli und Juventus weit mehr als das Abschneiden von GC, Sion, Servette oder Basel“ (Timau-'Juve', ein Stück Italia auf dem St. Jakob - Andreas Schluchter, BaZ 1.12.1986)
FC Internazionale Basilea:
„Erstmal seit dem kurzen Gastspiel von Juventus in den frühen siebziger Jahren spielt ein Gastarbeiter-Club in der zweiten Liga der Fussballer. Die im charakteristischen Schwarz/Blau-Gestreiften ihrer Lieblinge Inter Mailand antretenden Akteure sind eine Randbemerkung wert: Fussball ist ein Integrationsfaktor für Ausländer.
Bei der Gründung 1963 spielte man nur zum Plausch Fussball und war in erster Linie Fan-Club von Internazionale Mailand (Inter-Fanclub Kleinbasel). «Wir sind regelmässig nach Mailand an den Match gefahren» (...) Nach dem Aufstieg in die 3. Liga 1970 war während einer gewissen Zeit die Junioren-Mannschaft das Aushängeschild. Später hat man die Junioren-Abteilung aufgelöst und die 'Squadra' im Fussball der 'Grossen' integriert (...) Immerhin wird man von der nächsten Saison an wieder frisch aufbauen: ohne Junioren-Abteilung verliert man die Qualifikation für die Zweite Liga automatisch (...) Der Nachwuchs an sich wäre kein Problem: Buben italienischer Abstammung, die hier zur Schule gehen, schon längst Basler sind, aber weiterhin Italiener. Das gilt im Grunde genommen auch für das Fanionteam und ebenso bei den übrigen Mannschaften des Clubs, einer in der Vierten, zwei in der Fünften Liga (...) Im Sport werden sie voll akzeptiert, fügen sich in die vorhandenen Strukturen, ohne ihr Eigenleben zu vernachlässigen (...) Bei Internazionale ist man sich durchaus bewusst, dass man ein Bindeglied zwischen der alten Heimat und der neuen Umwelt geworden ist (...), der Fussball eine echte gemeinnützige Leistung vollbringt“
(Urs Hobi, BaZ 1.9.1978)
„Bereits auf 8.30 wurde dieses Spiel angesetzt - als Vorspiel zu einem Drittliga-Match des FC Breite! Offenbar will man in Basel den Gastarbeiterverein Internazionale schikanieren“ (2. Liga FC Internazionale - SV Sissach 0:3, Basellandschaftliche Zeitung 27.9.1978)
Internazionale Basilea stellte 1976 den Meister bei den B-Junioren.
«Wenn wir den Vergleich mit anderen Zweitliga-Clubs der Region ziehen, sind wir von der Struktur her einfach zu schwach (Vereinsorganisation, finanzieller Hintergrund). Von (sogenannten) Spesenentschädigungen kann ohnehin keine Rede sein, aber das Training kostet Geld, die Reisen und das Material. Auch die Matchunkosten sind beträchtlich. Spielerisch könnte man eher mithalten (...) Wir liegen im Training noch weit zurück. Spielertrainer Madonia und der beste Mannschaftsspieler sind am Tag vor dem ersten Meisterschaftsspiel aus den Ferien zurückgekehrt. Unsere Leute können ihren Urlaub nicht nach dem Terminkalender der Meisterschaft ausrichten» (Spiko-Präsident Giuseppe Pezzetta).
„Wir sind, wie andere Vereine mit italienischen Spielern, eine emotionelle Mannschaft - sehr schnell euphorisch, sehr schnell betrübt“ (Spielertrainer Michele Quaranta 1987: der in Frankreich aufgewachsene Italiener war neben Oberwil, Nordstern und OB beim FC Laufen in der NLB aktiv)
Unter dem neuen Präsidenten Primo Saligari rüstete der FC Internazionale Basilea ab 1985 mit Hilfe von Supportern und einer Sponsorengruppe kräftig auf. Auf dem Platz hatten nun nicht mehr nur die Italiener das Sagen. Jetzt galten aber sie, welche doch immer hartes Brot gegessen hatten, als Millionaris!
An der Delegiertenversammlung des Fussballverbandes im August 1987 folgte gegen den neuen Hecht im Karpfenteich eine Retourkutsche: die Ausländervereine hätten mit der Unsitte angefangen, für Amateurspieler Geld zu zahlen, äusserte sich der Vertreter des FC Grasshoppers. Ein Raunen ging durch den Saal (Zitat).
(Nachdem Transferzahlungen vorher unter dem Tisch getätigt worden waren, durften ab dem 20.6.1995 offiziell auch Amateurfussballer ohne Profilizenz für Spesen entschädigt werden. Vorgesehen wurden neu auch Ablösesummen als Ausbildungsentschädigung. Ein Club hatte ausdrücklich keine Entschädigung zu zahlen, wenn ein Spieler älter als 31 Jahre war, oder wenn der bisherige Club nicht zur Ausbildung des Spielers im Juniorenalter beigetragen hatte)
1988 gelangte Saligari mit einem Schreiben an die Schiedsrichter-Kommission, dessen Inhalt über Spannungen im Problemkreis seines Vereins mit den Schweizer Clubs und den Unparteiischen in der Presse veröffentlicht wurde: er prangerte die Diskriminierung und Verteufelung 'seiner an und für sich überlegenen Mannschaft' an: „womit wir allerdings nicht mehr bereit sind zu leben, ist die systematische Verunglimpfung unserer Herkunft, sind Verrohung und Brutalität im Sport, ist die andauernde Parteilichkeit, die von einem Grossteil der Schiedsrichter praktiziert, respektive begünstigt wird.“ Der damalige Präsident des Fussballverbandes, Vincenz Forelli, wies die Vorwürfe als Unterstellungen und ehrverletzende Behauptungen in aller Entschiedenheit zurück und warf Saligari bewusste Unfairness und Stimmungsmache vor. 'Dass Schiedsrichter - mit dem Ziel, Gastarbeitermannschaften Moral und Rückgrat zu brechen, sich fremdenfeindlich mit den Schweizer Gegnern zu Interessengemeischaften verbinden würden, könne abgesehen davon schon darum nicht stimmen, weil über ein Drittel selber Ausländer seien'.
Das Gefühl angeblicher Ungleichbehandlung als Ausdruck tief sitzender Demütigung zog sich wie ein roter Faden durch die Migrantenvereine: „überhaupt seien alle Schiedsrichter der Region nicht normal und einzig dann, wenn der Spielleiter von Bern oder Aarau anreise, werde die US Napoli Basilea gerecht behandelt“, hiess es noch 1996, als ein erboster Anhänger nach vier (!) Platzverweisen gegen seine Lieblinge auf den Platz gestürmt war, um dem Unparteiischen an den Kragen zu gehen.
Trotz der finanziellen Anstrengungen gelang Internazionale der Aufstieg in die 2. Liga erst 1992. In regionalen Pokal-Wettbewerb allerdings erwies man sich oft als Riesentöter („wenn Internazionale in Cupspielen gegen Zweitligisten antritt, ist oft kein Klassenunterschied festzustellen“):
„Dass der FC Internationale den Basler Cup gewinnt, ist beileibe keine Überraschung. Schon vor dem Finale wurden mit Gelterkinden, Birsfelden und Leader Muttenz drei Zweitligisten aus dem Cup geworfen. Dass aber Internazionale den Final gegen Allschwil so deutlich dominiert, das war nicht abzusehen. Bis auf wenige Szenen stand der Sieger dieser Partie nie zur Diskussion“ (Basellandschaftliche Zeitung 10.5.1991)
1991 qualifizierte sich die 3. Liga-Mannschaft nach einem Erfolg über den FC Breitenbach für die zweite Hauptrunde des Schweizer Cups, wo man sich dem SC Kriens (NLB) auf dem Bachgraben 0:4 beugen musste.
Zum 30jährigen Jubiläum 1995 musste eine neue Mannschaft auf die Beine gestellt werden, weil nach dem Wiederabstieg in die 3. Liga der gesamte Vorstand zurückgetreten war und sämtliche Spieler den Verein verlassen hatten. Die hochgezüchteten Ambitionen erledigten sich so schliesslich selber.
Für die Basler Anhänger von Inter Mailand war der Treffpunkt an der St. Jakobsstrasse 200 in einem Lokal auf dem Güterbahnhof Wolf.
AS Timau (II):
In die Fussstapfen trat unter den Gebrüdern Angelo und Arcangelo Nocera die ab 1995 von einem Möbelgeschäft unterstützte AS Timau, die unter Spielertrainer Marco Chiarelli (FC Riehen, FC Nordstern, BSC Old Boys) zur Nummer 1 der italienischen Fussballvereine in der Region aufrückte. Der Fehler von Internazionale, nur auf die erste Mannschaft zu setzten, sollte mit dem Ausbau der Nachwuchsabteilung und einem besseren Fundament vermieden werden. Die Promotion in die 2. Liga unter dem Spielertrainerduo Grava und Vidal machte eine Kooperation mit anderen Gastarbeiterclubs nötig.
Angelo Nocera, der in der Breite an der Zürcherstrasse ab 1969 ein Coiffeurgeschäft führte („welches zum Treffpunkt der Fussball-begeisterten Italianità wurde“), war als Spiko zum Präsidenten gewählt worden und führte den „ambitionslosen Verein mit rudimentären Strukturen“ nach oben: «Italiener der zweiten und dritten Generation sollen bei uns Zugang und ein Stück Heimat haben. Es darf nicht sein, dass alle Secondi zu Schweizer Clubs gehen müssen, weil für ihre Spielstärke kein geeigneter Verein existiert. Timau ist breit abgestützt, wird familiär geführt und hat starke Wurzeln. Ich möchte aufzeigen, dass auch ein ausländischer Verein in der 2. Liga bestehen kann»“ (Basellandschaftliche Zeitung, September 2001)
„Der Zusammenhalt ist traditionell gut. Viele Spieler kennen sich über Jahre. Da spielt die Herkunft keine Rolle, es spielen Italiener, Kosovo-Albaner, Spanier, Franzosen und sogar ein Schweizer zusammen“ (Basler Zeitung 2.9.2003)
10.9.1975: Nationalmannschaft Italien - FC Basel 6:0 (15'000 Florenz).
16.6.1976: FC Basel - AC Perugia 2:3 (1700 Stadion St. Jakob: Benefizspiel anlässlich der von der 1972 gegründeten Associazione Regionale Umbra di Basilea mit 330 Mitgliedern veranstalteten 'Umbrien-Tage')
Am 18. Februar 1981 fand im Stadion St. Jakob vor ca. 10'000 Zuschauern ein Benefizspiel zwischen dem FC Basel und dem SSC Napoli statt, dessen Reinerlös den Erdbebenopfern in Süditalien zugute kam. Die Organisation des von einem Galaabend begleiteten Anlasses übernahm der Dachverein der regionalen italienischen Sportvereine 'C.O.A.S.P.I.T.' (Comitato Ass. Sportive Italiane).
Autorizzazione a giocare, contingenti di stranieri:
Für Kopfschütteln sorgte 1988 das Komitee der 1. Liga, Azzuri Biel unabhängig vom Ausgang gegen den FC Pratteln den Aufstieg wegen zu vieler...Ausländer zu verwehren. Das Reglement schrieb vor, dass neben einem reinen Ausländer (Kategorie A) höchstens fünf assimilierte Ausländer (Kategorie C, bzw. sechs assimilierte Ausländer ohne Kategorie A) eingesetzt werden durften. Begründet wurde der Paragraph damit, auch aus Rücksicht auf die Auswahlteams die Gastarbeiter lieber in Schweizer Mannschaften integriert zu sehen.
Als Fussballschweizer ohne Schweizer Pass galt, wer seit mehr als sieben Jahren oder seit seinem 10. Lebensjahr ununterbrochen hier Wohnsitz hatte. Per 1. Mai 1990 wurde die Dauer auf fünf Jahre gesenkt. Grenzgänger (Kategorie B) wurden gesondert behandelt ('in der Mannschaft von Erst- oder Nationalligaclubs einer Ortschaft, die bis zu 20 km von der Landesgrenze entfernt liegt, dürfen zusätzlich zwei Ausländer mitwirken, sofern sie im Gebiet bis zu 20 km jenseits der Schweizer Grenze schon mindestens zwei Jahre Wohnsitz haben und nur mit Clubs des Grenzgebiets spielten').
Im Mai 1996 schaffte die Nationalliga nach dem Bosman-Urteil die bis anhin geltende 3+2-Regelung (drei Ausländer und zwei Assimilierte) und das Grenzgänger-Statut ab. Fortan konnten sieben ausländische Spieler auf dem Matchblatt notiert werden und gleichzeitig fünf ohne Schweizer Pass auf dem Platz stehen. Assimiliert bedeutete neu, im Juniorenalter mindestens vier Jahre in der Schweiz aktiv gewesen zu sein.
Ab der Saison 2004/05 galten Spieler aud dem EU-/ EWR-Raum nicht mehr als Ausländer.
Türkiye:
Der zwanzigjährige Türke und gelernte Metallbau-Schlosser Ertan Irizik, der mit dem Lohn als Fussballer seine Familie ernährte, sorgte über die sportlichen Qualitäten hinaus für Aufsehen. Für die verwitwete, nur türkisch sprechende Mutter und die beiden jüngeren Geschwister übernahm er eine Art Vaterfunktion und (wie danach sein Halbbruder Murat Yakin) den Kontakt mit Ämtern und Lehrern. Im Alter von zehn Jahren in die Schweiz gekommen, hatte ihm der Beitritt zum FC Concordia geholfen, sprachliche und soziale Barrieren zu überwinden. 1984 erhielt er einen Vertrag beim FC Basel („ein junger Türke setzt sich fernab seiner Heimat durch, findet sich in der Kälte Basels ebenso zurecht wie einst zuhause in Istanbul“ - Josef Zindel)
Gegen einen Antrag der Schweizer Demokraten („Bananenrepublik, Mafialand, Vetterli-Wirtschaft“) bürgerte der Baselbieter Landrat im Januar 1994 die Gebrüder Murat und Hakan Yakin in deren Wohngemeinde Münchenstein ein, nachdem selbst Bundesrat Adolf Ogi in einer nationalrätlichen Fragestunde für die beiden begnadeten Fussballer ein beschleunigtes, privilegiertes Verfahren als Angelegenheit von „erheblichem öffentlichen Interesse“ bezeichnet hatte.
(1976 hatte die Nationale Aktion wegen des Steuerdomizils des damaligen Nordstern-Trainers Zvezdan Cebinac interpelliert)
„Wir waren in meiner Juniorenzeit bei Concordia eine Multikultimannschaft, in der vorwiegend Ausländer spielten. Wir waren ein Paradebeispiel für Respekt und Toleranz untereinander. Es spielte überhaupt keine Rolle, woher ein Mitglied dieser Gemeinschaft stammte, jeder wurde akzeptiert“ (Murat Yakin 2003)
„Für sie war der Besuch des Unterrichts ein notwendiges Übel. Sie begannen erst am Ende der Schulstunden aufzuleben. Endlich frei, rannten die beiden Brüder zu dem kleinen holprigen Feld hinter ihrem Gebäude in der Christoph-Merian-Strasse. Dieses von Bäumen gesäumte Grünrechteck - nur drei Kilometer vom Sankt-Jakob Park entfernt, war der privilegierte Schauplatz ihrer ersten Heldentaten“ (Le Temps, 31.12.2002 über das schweizerisch-türkische Gebrüderpaar Murat und Hakan Yakin)
Eren Derdiyok, der seine Lehren abbrach und alles auf den Fussball setzte, schaffte über die unteren Ligen den Sprung ins Nationalteam. Später verriet er, dass er sich bei Wahlmöglichkeit für die Heimat der Eltern entschieden hätte. Seinen Erfolg führte er auf das stabile Umfeld der Familie zurück. Eray Cömerts (14 A-Länderspiele - „zwischendurch gab es die Überlegung, für die Türkei zu spielen, aber ich denke, das ist etwas ganz Normales“ - bz Basel 12.12.2019) Grosseltern kamen 1975 als Gastarbeiter aus Ostanatolien in die Schweiz.
„Türken, Türkei, da kommen bei vielen gleich Vorurteile hoch: Kriminalität (Haschisch- und Heroinschmuggel, organisierter Diebstahl), politische Extremisten und Terroristen, die hier Asyl suchen - sogar im Volksmund heisst es, wenn irgendwo geschummelt und betrogen wurde: «Da ist was getürkt worden» (...) Was hat das mit dem FC Anadolu zu tun? Sehr viel. Die Fussballer in diesem Verein (...) kämpfen nämlich nicht nur um Punkte, sondern auch gegen diese Vorurteile (...) dies äussert sich in Schimpfwörtern gegenüber den türkischen Spielern (...) Der Spiko-Präsident präzisiert jedoch, von wem der Psychoterror kommt: «Das sind nur die Zuschauer.» Reaktionen unter den Spielern Anadolus ruft dies nicht mehr hervor, aber es hat sie einiges an Gefühlsunterdrückung gekostet, um so weit zu kommen (...) Beim FC Anadolu soll der Fussball auch als Sozialhilfe dienen, um die jungen Spieler von der Strasse wegzukriegen, weg von den schädlichen Einflüssen einer Minderheit an Landsleuten, die für den schlechten Ruf der Türken verantwortlich sind“ (Martin Pütter, Basler Zeitung 11.10.1988)
Der zu seinen Spielen stets von einer zahlreichen Anhängerschaft begleitete Verein hatte jeweils gegen Saisonende ein ganz anderes Handicap. Neunzig Prozent der Mitglieder hielten sich an den islamischen Fastenmonat Ramadan. In der Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang durfte nicht nur nichts gegessen, sondern auch nichts getrunken werden.
Interne Spannungen zwischen Anadolu A und dem autonomem Anadolu B, das ausschliesslich aus Kurden bestand, wurden im Spätsommer 1990 publik, weil aufgrund zu wenig gestellter Schiedsrichter mit dem Senioren- Fünftliga- und eben erst aufgestiegenen (kurdischen) Drittliga-Team drei Mannschaften vom Verband nicht zugelassen und die Einsätze abwechslungsweise ausgetragen wurden. Während eines Trainings auf den Sportanlagen St. Jakob kam es im Oktober zu einer tödlichen Schiesserei.
1991 entstanden nach seinem Ausschluss („Schädigung des Ansehens des Fussballsportes, Verletzung der politischen und konfessionellen Neutralität“) separat neu Türkgücü und Güney: „es gibt viele junge türkische Talente im Raum Basel, doch uns fehlt das nötige Kleingeld, um solche Spieler zu verpflichten und ihnen das geforderte Salär zu bezahlen“ - Yalcin Cetinkaya 2002, Präsident des FC Türkgücü). Neu verfügten diese jetzt auch über Junioren, denn türkische Teenager waren vorher erst als Aktive zu Anadolu gestossen.
[Güney, das in der Saison zuvor den Reserven von Old Boys II rekordverdächtig mit 0:18 unterlegen war, meldete für die Meisterschaft 2008/09 aus finanziellen Gründen keine Mannschaft mehr. Im Vorstand hatte es Unstimmigkeiten gegeben, weshalb die 3. Liga-Equipe und die Senioren zurückgezogen wurden. Bereits in der Vorrunde 2007/08 hatte der FC Birlik aus Spielermangel seine 3. Liga-Mannschaft zurückgezogen: „besonders bedauerlich ist, dass mehrere inzwischen abgesprungene Spieler Geld verlangten, um ihren Vertrag zu verlängern“. Auch der FC Ferad stieg in die 4. Liga ab. Ein grundsätzliches Problem war die Überalterung]
[Türkgücü spielte 2017/18 in der 2. Liga regional („natürlich gibt es im Verein Erdogan-Befürworter und Erdogan-Gegner. Aber auf dem Fussballfeld sind wir neutral“ - Präsident, BaZ 30.9.2017)]
Neben Anadolu, das ab 1988 beim Schänzli ein eigenes Clublokal hatte, waren von der Massnahme, wegen nicht gemeldeter Schiedsrichter Mannschaften aus der Meisterschaft zu streichen, auch Internazionale (2), Jugos und Español (3) betroffen.
1994 drohte zwischen Güney und Türkgücü ein Spiel um den Aufstieg in die 3. Liga. Die Vereine liessen an einem geheimen Ort am grünen Tisch vorsorglich das Los entscheiden.
[Ähnlich ging der Verband 1999 vor, als er die 3. Liga-Rückrundenpartie zwischen Sloboda und Dardania wegen befürchteter Ausschreitungen absagen liess. Beim Hinspiel, welches die Albaner aus Angst vor Problemen zuerst hatten forfait geben wollen, mussten die 1000 Symphatisanten beim Betreten des Ausweichstadions Rankhof zur Überprüfung allfällig mitgebrachter Waffen durch einen Metalldetektor gehen („Eintritt bezahlt bei uns nur, wer es vermag. Denn bei unseren Zuschauern handelt es sich oftmals um Flüchtlinge, die wenig Geld haben“ - Trainer S. Z.). Ein paar Wochen später gegen Alkar vor 500 Besuchern auf dem Pfaffenholz brauchte es keine Massnahmen mehr]
Beim 1994 vom alevitischen Kulturverein angestossenen FC Birlik wirkten 2003 bereits italienische und schweizerische Fussballer mit. 60 Prozent der Aktiven waren noch gebürtige Türken. Wie andere Ausländer hatten man vor der Gründung zuerst bei einem Schweizer Verein mitgespielt, bevor man sich selbstständig machte („wir mussten zuerst etwas aufbauen, bevor wir eigenständig sein konnten (...) Das sei aber nicht als Rückzug ins nationale oder religiöse Ghetto zu verstehen“)
Die Idee des FC Ferad 1995 bei der Gründung war unter anderem, die ausländischen Jugendlichen zum Zwecke der Integration von der Strasse und aus den Spielsalons zu holen. Der Präsident befand 2003, dass der Verein trotz Durchmarsch in die 3. Liga noch an seinem Image arbeiten und sich besser präsentieren müsse. Als Grund sah er die ins Training und Spiel mitgenommenen Integrationsprobleme des Alltags.
Nachdem im April 1998 auf der Grendelmatte ein Schiedsrichter verprügelt worden war und ein grösseres Polizeiaufgebot ausrücken musste, wurde die Mannschaft von Baris Spor B für 12 Monate gesperrt. Der Verein wurde mit einer Busse von 2000 Franken belegt und die fehlbaren Akteure 1999 zu bedingten Gefängnisstrafen und einer Genugtuungszahlung verurteilt. Ein identischer Vorfall ereignete sich ein Jahr später, als der Schiedsrichter beim Spiel der Untersektion Hilalspor Rheinfelden gegen Pratteln spitalreif geschlagen wurde. Auch hier kam es wegen Körperverletzung zu einer zivilen Gerichtsverhandlung.
„Der SC Eisenbahner gewinnt die Partie der 5. Liga gegen Güney mit 3:0-Forfait. Das Spiel war nach vier Platzverweisen gegen Güney-Spieler sowie einem tätlichen Angriff eines Zuschauers auf den Schiedsrichter abgebrochen worden“ (Basellandschaftliche Zeitung 9.5.2000)
Anfangs Juli 1998 kam es beim Testspiel FC Basel gegen Galatasaray zu Auseinandersetzungen zwischen kurdischen und türkischen Gruppierungen, welche sich Steine der bröckelnden Stadionrampen zu Nutze machten. Mindestens sechs Personen wurden verletzt. Der Streit flammte auch später wieder auf. An einem Juniorenspiel 2017 zwischen Türkgücü und Ferad wurde eine Flagge mit dem inhaftierten Kurdenführer Abdullah Öcalan geschwenkt. Der Verband musste nach eingegangener Protestnote mit dem Hinweis auf das Verbot politischer Manifestation intervenieren (TagesWoche 17.3.2017) und teilte die Mannschaften in der 3. Liga in verschiedene Gruppen um.
Die ersten Arbeitssuchenden aus der Türkei waren in den frühen sechziger Jahren in die Schweiz gekommen, bevor ihnen der Arbeitsmarkt wieder verschlossen wurde. Am 11. September 1980 putschte in der Türkei das Militär und zwang Tausende zum Asyl. Ende 1996 zählte Basel-Stadt 7695 Personen mit türkischer Nationalität, der Schwesterkanton Baselland 5563.
Eine Sensibilisierung setzt ein:
„Tätlichkeiten unter Spielern und gegenüber dem Schiedsrichter gehören heute zum Alltag auf den regionalen Fussballplätzen. Nur wenige Fälle werden in der Öffentlichkeit bekannt“ (Basler Zeitung, Herbst 2000)
Der Verbandspräsident Hans-Jürg Ringgenberg musste im November 1999 im Basler Regionalfernsehen Rede und Antwort stehen ('Telebar'), und die Auswüchse thematisierte die Magazinsendung 'Time Out' auf SF1.
„Es gibt keine andere Möglichkeit als saftige Bussen, die weh tun und Vereine und Spieler zur Vernunft bringen“, meinte etwas fatalistisch im Mai 2000 der Präsident der Wettspielkommission, nachdem Vorfälle des Viertligisten FC Sloboda mit 2000 Franken geahndet worden waren.
Sanktionen grenzten jeweils ein (nicht kausales) Verhalten einzelner fehlerhafter Spieler klar ab. Als ultima ratio wurde ein Verein bei Ausbleiben der Zahlungen (vorübergehend) gesperrt.
Nachdem im November 2006 bereits die B-Junioren des FC Türkgücü nach 'dem seit Jahren gravierendsten Vorfall' (gegen den Schiedsrichter in Aesch) suspendiert werden mussten („die soziale Struktur eines Sportteams hat einen grossen Einfluss auf die Gewaltbereitschaft [...] Das Frustpotenzial bei eher besser ausgebildeten, wohlhabenderen Jugendlichen aus stabilen sozialen Verhältnissen ist tendenziell weniger hoch“ - D.W.), kam es 2009 zu mehreren Vorfällen um den 4. Liga-Club SC Genclik. Der Gedanke einer eigenen Ausländerliga wurde wieder aufgebracht, was beim Präsidenten des Nordwestschweizer Fussballverbandes auf gar keine Gegenliebe stiess:
„So etwas wird es unter meiner Leitung hier nicht geben, das ist ganz klar. Es gibt für mich keine Ausländerdiskriminierung“ (Roland Paolucci)
Am 24.9.2009 startete als vorerst letzte Massnahme gegen die Sittenverluderung auf dem Fussballplatz das vom Kanton (Erziehungsdepartement) bezahlte Projekt 'Zoffstopp', mit dem auch „andere Problem-Quellen wie Rassismus, Drogen, sexuelle Übergriffe oder Doping jenseits der üblichen Repressionmittel angegangen werden sollen“ (onlinereports)
Den Schreckensmeldungen mit Spielabbrüchen oder verwüsteten Garderoben (Sportplatz Gymnasium Oktober 2006, C-Promotion FC Laufen - FC Nordstern) setzte der FVNWS eine Fairplay-Kampagne entgegen, deren erstes 'be-TolearanT-Spiel', bei dem Jugendliche für ein besseres Verständnis der Rolle des Schiedsrichters die Partie selber leiteten, am 4.11.2006 auf dem Spiegelfeld in Binningen zwischen den B-Junioren des lokalen Vereins und dem FC Telegraph stattfand. Von einer 'erfolgreichen Kleinarbeit über offene, vermittelnde Gespräche mit den verkrachten Vereinen oder Übeltätern' konnte der Verbandspräsident 2008 berichten.
Ab der Saison 2006/07 hatten wegen der mangelnden Wirkung von Spielsperren Rotsünder bei einer Tätlichkeit oder Schiedsrichterbeleidigung bei den A- und B-Junioren eine Geldbusse zwischen 40 und 120 Franken zu bezahlen. Ein Flyer nahm vor Kinderspielen die anwesenden Eltern in die Pflicht.
Seit 2007/08 zählen bei Punktgleichheit die Anzahl Strafpunkte (Fairnessrangliste). Auch das Shakehands, welches vorher nur auf freiwilliger Basis gemacht wurde, wurde eingeführt.
Mit dem Projekt 'Weisse Weste in Zusammenarbeit mit der Basellandschaftlichen Kantonalbank und der Basellandschaftlichen Zeitung wurde als 'Mahn- und Weckruf' ab der Saison 2008/09 fünf Jahre lang der fairste Baselbieter Verein prämiert. Eine gemeinsame Fairplayaktion von tiim sport und bz für die regionale 2. Liga startete mit der Saison 2007/08.
In Sachen Prävention nahm der Fussballverband Nordwestschweiz mit einem Integrationsbeauftragten als Anlaufstelle für ausländische Spieler und Clubs bereits ab 2002 eine Vorreiterrolle ein. An der Delegiertenversammlung in Stein wurde dafür der spätere Grossrat Hasan Kanber (FC Birlik) als erstes Mitglied eines Ausländervereins überhaupt in den Vorstand gewählt.
Ausländisch geprägte Amateurmannschaften machten in der Zwischenzeit rund 50 Prozent der gemeldeten Teams aus. Kanber bekam den Auftrag, in Fragen und Konflikten den Dialog mit den verschiedenen Parteien zu suchen und das Gefühl zu vermitteln, gegenüber den Schweizern nicht benachteiligt zu werden.
„Wir haben ein Augenmerk darauf gelegt, wie die Vereine organisiert sind. Ob es überhaupt demokratische Strukturen gibt und wenn nicht, wollten wir deren Einführung veranlassen. Sonst ist es schwierig die Entstehung solcher Probleme zu verhindern. Vor allem bei Migrationsklubs, wo teilweise in ihrer Heimat verfeindete Gruppen aufeinandertreffen (...) Der Erfolg einer Gemeinschaft hängt immer auch vom gesellschaftlichen Umfeld ab. Von der ausländischen Bevölkerung erwartet man, dass sie sich integrieren soll. Das ist aber keine Einbahnstrasse, das muss beidseitig gefördert werden“ (bz Basel 17.2.2012)
„Ausländervereine sollen die Regeln auf dem Spielfeld und die Strukturen der Vereinsarbeit besser kennen lernen“ (BaZ 5.11.2003)
„Die Schlüsselpositionen müssen mit Leuten besetzt werden, die in die hiesige Gesellschaft integriert sind. Das hilft innerhalb des Vereins, weil sie den Clubmitgliedern gewisse Werte mitgeben können. Zudem ist das auch gut für die Aussenwirkung. Ein Präsident, der deutsch spricht, kann sich besser artikulieren und die Interessen des Vereins vertreten. Zudem plädiere ich dafür, dass die Vereine nur mit ausgebildeten Trainern arbeiten. Das ist die beste Gewaltprävention“ (Tahir Citaku, FC Dardania 2006)
Der Verein des Präsidenten, dem die Inklusion ein besonderes Anliegen war, organisierte 2003 zusammen mit dem Basler Anti-Rassismus-Projekt 'Pronto21' ein Turnier mit Fussballern aus zwölf Ländern. 2008 fand in Zusammenarbeit mit der Ausbildungs- und Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten als eine Art 'Mini-Euro' der Anlass auf den Sportanlagen Bachgraben zum fünften Mal statt.
Ziel eines anderen Projektes (Sprachschule Deutschimpuls Basel) mit dem Namen 'Kicken Sie Deutsch' war als Kombination von Fussball- und Sprachtraining ab 2007 die Integration von Ausländern und ein Beitrag zur Gewaltprävention.
2004 gewann der Fussballverband Nordwestschweiz für sein Engagement den Basler Integrationspreis. Unter den 100 von ihm betreuten Mitgliedern waren bereits 28 reine Ausländervereine, und von 15500 aktiven Spielern besassen 40 Prozent keinen Schweizer Pass.
Africa:
(die erste 'Negermannschaft' - Zitat aus Arabern und sechs aus dem angrenzenden Sudan eingewanderten 'waschechten Negern' - Zitat konnte für Basel im Juni 1927 anlässlich der Europatournee des Ägyptischen Meisters Arsenal Kairo angekündigt werden. Die überraschend grosse Zuschauermenge auf dem Rankhof hätte sich wohl nicht aus den zuletzt gezeigten Leistungen erklärt, sondern um einmal Exoten Fussball spielen zu sehen, befand der Berichterstatter)
1945 traten zwei in Lörrach, bzw. später im Elsass stationierte Auswahlmannschaften des 5. Marokkaner-Regiments zu ihren Rückspielen gegen den FC Polizei und den SC Ciba vor tausend Zuschauern in Basel an:
„Die Durchsetzung der Mannschaften mit echten Afrikanern war für diesmal bescheidener als in den Spielen jenseits der Grenze; dafür entschädigte ein gleichfalls brauner und charmanter Besuch auf dem Landhof: Josefine Baker, die eine gute halbe Stunde dem wechselnden Kampf um den Ball zusah!“ (NZ 29.10.1945)
Spieler schwarzafrikanischer Herkunft waren noch Ende der 80iger-Jahre auf den Fussballplätzen der Schweiz selten. Von den Rängen schlug ihnen der Rassismus mit unverhohlener Direktheit entgegen, wie es zum Beispiel die Basellandschaftliche Zeitung anlässlich des NLB-Derbys FC Basel - BSC Old Boys zum Saisonauftakt der Saison 1989/90 festhielt:
„Der dunkelhäutige Holländer Etienne Verveer (Verveer war ein 25jähriger Arztsohn mit Wurzeln im Surinam) spielte am Samstag nicht nur wegen seines Fehlers, der zum vorentscheidenden 1:0 führte, die Rolle des tragischen Helden. Bei sämtlichen Ballkontakten wurde er von einer Gruppe rassistischer Zuschauer (...) mit Affengeräuschen bedacht. Diese Geräuschkulisse verstummte auch nicht, als sich Verveer nach 20 Minuten wie durch Butter durch die Basler Abwehr dribbelte, noch kehrte nach verschiedenen Feldpredigten des Speakers Otto Rehorek Friede ein“ (Jürg Gohl, 24.7.1989)
Anlässlich der Partie der Auf-/Abstiegsrunde FC Basel - FC Zürich vor einer für damalige Verhältnisse grossen Zuschauerkulisse wurden 1990 die beiden dunkelhäutigen 'Alleinunterhalter', der im südafrikanischen Schwarzen-Ghetto Soweto aufgewachsene Makalakalane und der Kolumbianer Tréllez beleidigt, denen aus der Muttenzerkurve Bananen entgegenflogen. Der Berichterstatter meinte, „mit den zahlreichen Rassisten im Joggeli“ anscheinend leben zu müssen.
Der FC Basel verpflichtete 1995 mit Alex Nyarko (Ghana) und Gabriel Okolosi (Nigeria) die ersten Fussballspieler aus Afrika relativ spät. Bereits im Herbst 1993 hatte der NLB-Konkurrent Old Boys den 18-jährigen Ghanesen Godfried Adoube übernommen.
Beim Cupspiel gegen Gossau im März 1996 trugen zusammen mit dem 17jährigen Binninger Debütanten Oumar Konde erstmals vier dunkelhäutige Spieler das rotblaue Leibchen, was zu einem unschönen Nachspiel führte („habt ihr auch noch weisse Spieler?“).
Nyarko war vom Möbel-('Lipo') und Spielerhändler Robert Zeiser gekauft worden („es gibt Leute, die investieren in Aktien, ich investiere in Fussballer“). Der Filmer Peter Aschwanden widmete dem Ghanaer, der mit seiner Freundin zurückgezogen im Matthäus-Quartier lebte, auch aus Interesse über diesen neuen Handel ein Porträt:
„Ich kenne Nyarko vom Sehen. Ich sehe ihn von meinem Bürofenster an der Ecke Efringer-/ Oetlingerstrasse aus, wo er auf jemanden wartet, der ihn zum Training, zum Spiel abholt. Immer im Trainingsanzug des Clubs, immer mit Walkman, mit Migrossack und Trainingstasche: ich kenne ihn vom Einkaufen, vom Anstehen an der Kasse“
Zeiser verhalf später dem FC Concordia mit zwei günstig zur Verfügung gestellten Brasilianern zum Klassenerhalt, indem er die Differenz ihrer Lohnvorstellungen selber übernahm.
Im Herbst 2000 führte der Torjubel des Kameruners Jean-Michel Tchouga (FC Basel) zu einem rassistisch gefärbten Text des Vizepräsidenten des Schweizerischen Schiedsrichterverbandes. Offenbar würden vorwiegend afrikanische Spieler nach dem Torjubel am Zaun hochklettern oder Jubeltänze aufführen, meinte er und verglich die Fussballer mit Affen in einem zoologischen Garten („manche führten sich so auf, wie wenn sie einen Alkoholrausch hätten, der Gang erinnere an einen Zustand unter Drogeneinfluss“). Die Medien reagierten scharf und selbst die Nachrichtensendung des Schweizer Fernsehens '10 vor 10' berichtete darüber.
Tchouga schilderte später den Druck durch den Stellenwert der Familie in Afrika: als es dort zu Problemen kam, waren seine Leistungen schwächer geworden, worauf er seinen Stammplatz verlor.
2009 wurde der gebürtige Ghanaer und FCB-Junior Kofi Nimeley, der mit sechs Jahren nach Muttenz gekommen war, mit seiner zweiten Heimat in Nigeria U17-Weltmeister („da ich der einzige schwarze Spieler im Schweizer Team war, wurde mir während der WM immer zugejubelt. Die Fans schrien meinen Namen. Ich genoss das sehr und wollte den Afrikanern zeigen, dass sie es auch schaffen können“ - Basellandschaftliche Zeitung 28.12.2009).
Zu einem der beliebtesten Schweizer Fussballer überhaupt avancierte Breel Embolo, der 2004 aus der kamerunischen Hauptstadt Yaounde nach Basel gelangt war. Die Fans widmeten ihm einen eigenen Song. Afrikanische Wurzeln hat auch der Baselbieter Nati-Stürmer Noah Okafor, dessen Vater aus Nigeria stammt.
Ab 1992 gab es auch in der Region einen von damals insgesamt zehn 'Africa Foot Clubs', die nicht zuletzt als Ersatz für die zurückgelassenen Angehörigen einen wichtigen Beitrag leisteten.
Im Oktober 2007 fand im Rahmen einer Veranstaltungsreihe der Eglise Française de Bâle auf dem Gartenhof ein Spiel zwischen einer Allschwiler Junioren Selection und dem sich aus exilierten Kamerunern zusammengesetztem Team des FC Camfoot statt, das dank den Kontakten des ehemaligen Stürmer des FC Basel Jean-Michel Tchouga zustandegekommen war.
Jugoslavija:
2. Liga, FC Concordia Basel - FC Jugos 2:1 (1979):
„Bemerkenswertes Element des ganzen Spiels war die Stimmung unter den nicht weniger als 500 Zuschauern - zum allergrössten Teil Landsleute des Gästeteams, die dieses immer wieder in einer völlig 2. Liga-fremden Art antrieben“ (BaZ 10.9.1979)
„Die Jugoslawen hätten das Potential, um vorne mitzumischen, aber jedes Jahr zu Beginn der Rückrunde kommt der grosse Hammer. Die technischen Virtuosen sind Schönwetterfussballer und bekunden in der kalten Jahreszeit immer grosse Mühe“ (Saisonvorschau 3. Liga 1988, Andreas Müller)
Die Jugoslawen stellten nach den Italienern das zweithöchste Ausländerkontingent.
Der in der Heimat ausgebrochene Bürgerkrieg schlug zunächst nicht auf die beiden regionalen Vertreter durch, die sich über den Fussball hinaus als Anlaufstation für ihre Landsleute verstanden. Dem seit 1985 bestehenden und 1990 eigenständig gewordenen FC Sloboda („wir wollten endlich mal unter unserem eigenen Namen starten. Dazu kam, dass wir Timau jährlich bis zu 2500 Franken zahlen mussten, um überhaupt an der Meisterschaft teilnehmen zu können“) soll es egal gewesen sein, ob die knapp 40 Aktiven Kroatien, Bosnien/Herzegowina oder Serbien entstammten (Zitat September 1991), und bei Jugos hatte es zu dieser Zeit 'sogar' vier Albaner im Kader. Nach und nach aber bildeten sich entsprechend der Gruppenzugehörigkeit im Vielvölkerstaat autonome Vereine heraus:
- NK Dinamo/ NK Pajde Möhlin 1989: Pajde war ursprünglich eine Grümpel- und Hallenturniermannschaft. Als immer mehr Leute zum Club stiessen, lag die Gründung eines Vereines auf der Hand. Nachdem der SV Augst seiner Untersektion die Zusammenarbeit mit der Begründung, der Platz sei überlastet, gekündigt hatte, nahmen die Kroaten auf dem Bata-Areal in Möhlin nach einem Jahr Pause unter eigenem Namen an der Meisterschaft teil. 1993 organisierte Pajde erstmals in der Region ein Turnier für Mannschaften der Diaspora:
„Zu jener Zeit, als durch den Jugoslawienkrieg Tausende von Kroaten in die Schweiz zogen, war der Verein Treffpunkt vieler Heimatloser. Luka Rakitić kümmerte sich um sie, gab ihnen mit dem Fussball ein wenig Beschäftigung“ (Fussballmagazin 11 Freunde)
Reglementarisch vorgeschriebenen 11er-Nachwuchs wegen des angestrebten 2. Liga-Aufstieges gab es bereits 2009, als vom Dorfrivalen FC Möhlin-Riburg/ACLI ein komplettes Team übernommen wurde. Über das Wochenende des 22. und 23. Mai 2010 war der NK Dinamo Gastgeber der dritten Ausgabe der Europameisterschaft Kroatischer Fussballvereine ausserhalb Kroatiens. Zur Promotionsfeier 2012 gastierten mit 'Rakitic & Friends' zur Unterstützung des in der Verantwortung stehenden Vaters Mladen Petric, Boris Smiljanic, Ivan Klasnic und Mario Gavranovic auf dem Sportzentrum Steinli. 2015 brüskierte der Club den Verband, weil er wegen dem Turnier der kroatischen Teams in der Heimat nur mit einer B-Mannschaft zum Finalspiel um den Basler Cup antrat. Ab 2016 arbeitete man im Nachwuchs mit dem FC Möhlin-Ribburg/ACLI zusammen. 2021 zog sich die erste Mannschaft um den Bruder von Ivan Rakitic nach dem Abstieg aus der 2. Liga inter wegen Spielermangel kurz vor Saisonbeginn aus der 2. Liga regional zurück.
- NK Alkar 1991 als erste eigenständige kroatische Fussballmannschaft in der Nordwestschweiz:
„Die wesentliche Bedeutung des Fussballs könnte in der Tatsache begründet liegen, dass die Nation, die sich in den 1990er Jahren im Aufbau befand, die Symbole der Identität brauchte, ein Konzept, das die Menschen verbindet und ein Gefühl der Einheit schafft“ - Tibor Komar, 'Der Stellenwert des Sports in Kroatien'
- FC Dardania 1993: der 1995 eigenständig gewordene Verein mit damals beinahe 1000 Mitgliedern bestand ausschliesslich aus Albanern, die aus dem ehemaligen Jugoslawien, vornehmlich aus dem Kosovo, aber auch Mazedonien oder Bosnien stammten. Torhüter Jeton Bislimi (FC Nordstern) wurde Fussballprofi beim FC Prishtina (2000). Aufstieg in die 2. Liga 2007 unter Spielertrainer Enver Hajdari:
„Unser Verein wird albanisch geführt, angereichert durch schweizerische Methoden (...) unsere Matches sind ein gemeinschaftsfördernder Anlass, rund 400 Personen gehen jeweils zu den Meisterschaftsspielen auf den Sportplatz Bachgraben“ (Zitate 1997)
- FK Vardar 1994 (nach dem mazedonischen Vorbild Vardar Skopje)
- NK Posavina 1995:
„In den vergangenen Jahren hatten die Clubmitglieder die Ehre, von hochrangigen Funktionären aus ihrem Heimatland und bei zwei Gelegenheiten von den Clubs Dinamo Zagreb mit Robert Prosinecki und Hajduk Split besucht zu werden“ (Homepage des Vereins 2007). Die Kroaten waren 2004 nach dem Aufstieg in die 3. Liga zu ihrem ersten Spiel von rund 300 Landsleuten nach Binningen begleitet worden.
„Alle, ob Spieler oder Leute aus dem Umfeld, wussten alles besser. Seriöse, vor allem ruhige Aufbauarbeit, war gar nicht möglich. Bei Erfolgen sind alle sofort euphorisch und sehen sich als eine Art Roter Stern Belgrad. Bei Niederlagen bricht Panik aus, und die gegenseitigen Schuldzuweisungen lassen einen verzweifeln“ (der frühere Fussballprofi Damir Maricic - BSC Old Boys, FC Riehen - über das Mentalitätsproblem seiner von ihm angeleiteten Landsleute; Basellandschaftliche Zeitung 1.1.2008)
Auf die Politik angesprochen, legten die Verantwortlichen des FC Jugos 1996 Wert darauf, für alle Nationalitäten offenzustehen und 1991 gütig auseinandergegangen zu sein. Der Zweitliga-Aufsteiger, der sich zum Ziel setzte, jugoslawische Elemente wie Technik, Ballfertigkeit und Schnelligkeit mit Schweizer Tugenden (Kampfgeist, Disziplin, Physis) zusammenzubringen, präsentierte eine bunte Mischung aus Schweizern, Italienern, Brasilianern und aus den mittlerweile neu entstandenen Gebieten. Der interne Aspekt („Fussball bedeutet für uns Kommunikation“) schlug sich im von ihm organisierten Turnier ('Dan Evropski Novost') mit jugoslawischen Mannschaften aus verschiedenen europäischen Ländern nieder.
1998 stieg Jugos als damals dienstältester Drittligaclub (nebst zwei Zweitligaaufstiegen) erstmals ab.
2005/06 „mit Spielern längst nicht mehr mit Herkunft nur aus Ex-Jugoslawien“ erreichte man noch einmal die 2. Liga.
Sorgen bereiteten die ethnischen Differenzen bei Cupspielen, welche entgegen der Einteilung in der Meisterschaft („wir werden sicher dafür sorgen, dass der FC Alkar, der FC Jugos und der FC Dardania in der 3. Liga in verschiedene Gruppen eingeteilt werden“ - Hansruedi Weber, Präsident der Wettspielkommission 1997) nicht berücksichtigt werden konnten.
Weil sich der Verband weigerte, die Auslosung zu steuern und konfliktträchtige Paarungen a priori auszuschliessen („wir sind hier in der Schweiz und können uns nicht mit den politischen Problemen in Jugoslawien auseinandersetzen“), kam es 2004 durch das Los Jugos gegen Dardania, wie es kommen musste. Die Polizei veranschlagte für das Sicherheitsdispositiv fünfstellige Kosten, welche niemand übernehmen wollte und empfahl eine Verschiebung. Mit ein paar Patrouillen im Umfeld des Leichtathletikstadions konnte das Spiel schliesslich über die Bühne gebracht werden. Dardania, das einen Forfaitsieg ausgeschlagen hatte, gewann mit... 3:0.
Viele Jahre später durften im August 2011 doch noch die Fäuste fliegen: die Begegnung der 4. Liga Gruppe 3 zwischen Dardania II und dem FK Beograd wurde nach einer Massenschlägerei unter Beteiligung von Zuschauern und Spielern vom Schiedsrichter abgebrochen.
Beim FC Basel standen zu jener schweren Zeit mit Smajic, Tabakovic und Saric drei bosnische Verstärkungsspieler unter Vertrag, die wegen des Konfliktes von ihrer Heimat abgetrennt waren.
2001 wechselte der bosnische U21-Internationale Josip Colina (FC Nordstern, FC Basel, FC Concordia) zum italienischen Serie C-Verein Varese.
Der 15-fache albanische Internationale Arian Peço spielte von 2001 bis 2006 in der Challenge League für den FC Concordia und wurde in der Region heimisch.
Ivan Rakitić (FC Sevilla, FC Barcelona: „Kroatien ist für mich die Heimat, aber ich bin auch ein Aargauer“ - Zitat 2007), Xherdan Shaqiri (FC Bayern München, FC Inter, FC Liverpool), Granit Xhaka (Borussia Mönchengladbach, FC Arsenal, Bayer Leverkusen - U17-Weltmeister 2009), Albian Ajeti (FC Augsburg, West Ham United, Celtic Glasgow, SK Sturm Graz), Beg Ferati (SC Freiburg) oder Miloš Veljković (SV Werder Bremen) heissen die bekanntesten Söhne dieser Einwanderergeneration vom Balkan, welche es in die grosse Welt des Fussballs geschafft haben. Pendler zwischen den Herkunftsländern ihrer Väter und einer neuen Heimat - vielleicht hier, vielleicht auch da.
Multikulti statt Kommunitarismus, verwischte Identität:
Aus dem Ausland gelangten Akteure vermehrt auch in die unteren Ligen, zumal sich mit dem Fussball mittlerweile ein Zubrot verdienen liess. Traurige Bekanntheit erlangte der 25-jährige Norberto Cesar vom SC Baudepartement, der im Februar 1995 tödlich verunfallte. Zugunsten der Witwe und dem wenige Tage später geborenen Sohn wurde zwischen dem FC Basel und einer 'Super11' von in der Schweiz tätigen Auslandprofis auf Initiative seines damaligen Trainers Karli Odermatt ein Benefizspiel ausgetragen. Cesar war 1990 von den Kapverischen Inseln in die Schweiz eingewandert, sich eine neue Existenz aufzubauen.
Der Asylbewerber Jean-Pierre Lumvutu, der beim FC Laufen untergekommen war („wo er als technisch brillanter Stürmer für Furore sorgte“), wurde 1999 in den Kongo zurückgeführt, nachdem sein Gesuch abgelehnt worden war. 2001 wurde von den Medien der Fall eines 1998 vor dem Krieg geflüchteten Kosovaren aufgegriffen, dem trotz abgeschlossener Lehre als Stütze der ersten Mannschaft des FC Reinach („er spricht sogar Basler Dialekt“) trotz 500 gesammelter Unterschriften die (letztlich verhinderte) Ausschaffung drohte.
Als erste Multikulti-Mannschaft der 2. Liga der Nordwestschweiz galt in den 90er Jahren der SC Baudepartement. Zum Rückrundenauftakt 1996 figurierte nur noch ein gebürtiger Schweizer in der Startelf:
„Wir haben mehr Spieler mit fremdländischen Namen in unserem Kader als andere Vereine. Aber das sind alles ehrenwerte Leute. Darunter sind Familienväter, die einer geregelten Arbeit nachgehen und auch ihre Steuern bezahlen. Der einzige Unterschied ist, dass ihr Name meistens mit 'ic' endet“ (Spiko-Präsident Hans Fankhauser, Basellandschaftliche Zeitung 4.5.1996)
Der Spielertrainer sprach 1998 die Provokationen von Gegenspielern, überharte Fouls und das fehlende Fingerspitzengefühl der Schiedsrichter an:
„Ein Foul ist bei uns immer gleich eine Tätlichkeit, ein Zusammenstoss eine Provokation, und eine Diskussion wird als Bedrohung empfunden. Im Zweifelsfall wird gegen uns entschieden“ (Gerry Fanciulli). Auf den Einwand, dass die Old Boys mit ihm und (gerade wegen der) zahlreichen assimillierten Spielern damals eine Erfolgsgeschichte gewesen waren, antwortete er, sie seien eben Italiener und die Endsilben hätten nicht auf 'vic' geendet. Einen Stempel zu haben, stinke ihm echt, es seien alles anständige Kerle, die meist schon lange in der Schweiz sind.
„Ich habe beim SC Baudepartement in Basel als einziger Schweizer in einer Mannschaft mit nur Ausländern gespielt. Von meinen Gegnern, den Schweizer Gegnern, wurde ich oft aufs primitivste angepöbelt. Warum kannst du nur mit denen spielen? Es war zum Teil unausstehlich“ (André Dosé, früherer CEO der Fluggesellschaft Swiss - Tageswoche 14.5.2013)
Zum Dauerbrenner wurde der mit 21 Jahren zum Verein gestossene Serbe Ljubisa Obradovic (FC Gundeldingen, FC Jugos). Auch wegen ihm fanden zahlreiche Ex-Jugoslawen den Weg auf den Satusgrund/ Rankhof. Obwohl während des Balkan-Krieges Serben, Kroaten, Bosnier und Albaner in derselben Mannschaft spielten, kam es zu keinen negativen Vorfällen („auf dem Terrain war die Herkunft nie ein Thema“):
„Diese Menschen sind, da sie weniger verwöhnt als die Schweizer sind, extrem hilsbereit und haben so wenig Mühe, sich zu integrieren“ (Spiko-Präsident SC Baudepartement, Hans Fankhauser)
Angesprochen auf die Zunahme der Brutalität, wurde von den Protagonisten der 2. Liga im Jahr 2000 die Vermischung der verschiedenen Kulturen mit abweichenden Lebensauffassungen als Grund angegeben.
„Da stehen oft Menschen aus einem Dutzend Länder auf dem Feld. Diese kunterbunte Mischung, dieses Sprachengewirr unter einen Hut zu bekommen, ist für die Schiedsrichter keine leichte Aufgabe“ (Carmelo Magro, Mittelfeldspieler beim SC Dornach)
„Die Sprache des Sports ist international, die Sprachbarrieren, die in anderen Bereichen eine Durchmischung stark behindern, sind im Sport, bei dem primär die körperliche Leistungsfähigkeit zählt, verhältnismässig niedrig“ (Jeremy Stephenson, Strafgerichtspräsident Basel-Stadt)
Auf 25 Prozent wurden anfangs der Jahrtausendwende die sogenannten 'Mischvereine' geschätzt. Reine Ausländervereine gab es etwa gleich viele:
„Erwähnenswert scheint mir auch, dass unser Team der Zeit einen grossen Schritt voraus ist. Dank Spieler verschiedener Nationalitäten verkörpern wir bereits das Vereinte Europa“ (Franco Di Benedetto, Trainer der Italienermannschaft des FC Oberdorf)
Auch die Drittliga-Mannschaft der AC Rossoneri 2005/06 war als ein solches Beispiel bereits eine bunte Durchmischung von Schweizern, Italienern, Türken und Ex-Jugoslawen („den Höhepunkt des Vereins bildet jeweils Ende Oktober der Tanzabend in der Mehrzweckhalle“).
„Wo heute Türken neben Tamilen, Italienern, Albanern, Serben und Kroaten leben und alle aneinander vorbeikommen müssen. Die Schweizer sind gegangen, gekommen sind die Zuwanderer (...) Rosental 52,9 Prozent Einwohner ausländischer Herkunft, Matthäus 50,2 Prozent, Clara 44,5 Prozent (...) Auf der anderen Seite des Rheins (...) sind die Verhältnisse genau umgekehrt (...) Der FC Nordstern steht im Zentrum des Wandels. Er ist eine der ersten Adressen für Zuzüger und deren Kinder (...) In den 90er-Jahren habe die Veränderung im Club, in dem früher fast ausschliesslich Schweizer spielten, eingesetzt (...) Schweizer sind weggezogen oder wechselten die Sportart, fingen an, Tennis zu spielen oder Handball (...) Der Verein sei immer ein Spiegelbild des Kleinbasels gewesen:
Vor ein paar Jahren wurde erstmals ein Ausländer in den Vorstand gewählt, auf den Mitgliederlisten gibt es eigentlich nur noch bei den Passiven einen gewichtigen Anteil Schweizer (...) Die Eltern der ausländischen Junioren engagieren sich genauso stark für den Club, vielleicht sogar noch mehr (...)
Stimmt die Durchmischung der Mannschaft nicht, gibt es etwa ein Übergewicht einer bestimmten Nationalität, komme es schon zu Grüppchenbildung und Ausgrenzung“ (Der FC Nordstern hat sich in den letzten Jahrzehnten zum Migrantenverein gewandelt - Renato Beck, Basler Stadtbuch 2009)
'Club nel club' o in modo independente:
In den 90er Jahren folgte durch die Abspaltung von Unterabteilungen, deren Zugehörigkeit und die Durchmischung mit dem Stammverein mehr oder weniger statuarisch gewesen war, ohne durchschlagenden Erfolg schliesslich eine letzte Welle von Gründungen. Segen oder eben Fluch, denn id der vorherigen Organisation schienen sie häufig besser aufgehoben. Ab 1991 musste eine Mannschaft für die Aufnahme in den Spielbetrieb nicht mehr über ein eigenes Spielfeld verfügen. Trotzdem stellten die Anforderungen an die Infrastruktur neben der Schiedsrichterpflicht und der vorgeschriebenen Satzung den grösster Stolperstein dar.
Für die Autonomie nahmen Neugründungen auch einen allfälligen Abstieg in Kauf, denn sie mussten in der untersten Klasse der 5. Liga neu beginnen.
(Mit Beschluss vom 14. Januar 1994 kam der Verband wegen der noch im Bau befindlichen staatlichen Anlagen Rankhof und Pfaffenholz auf die Aufnahmeregelung neuer Vereine zurück und sistierte die laufenden Gesuche von AS Milena, Italsatus und FC Tartania)
„Heute werden immer mehr ausländische Clubs gegründet. Ich muss klar sagen, dass wir das nicht fördern. In unserem Sinne wäre es eher, wenn sich die Ausländer (wie früher) in bestehende Clubs integrieren würden“ (Verbandspräsident Hans-Jürg Ringgenberg 1996)
„Viele Clubs hatten lange Jahre Untersektionen mit Ausländermannschaften. Diese machen sich nun aus verschiedenen Gründen selbstständig. Unter anderem auch, weil etliche dieser Vereine von ihrem Stammclub ausgenutzt wurden. Es gab in einigen anderen Regionen sogar Fälle, wo ausländische Teams pro absolviertem Heimspiel einen Betrag an den Stammverein zahlen mussten“ (Hans-Jürg Ringgenberg)
„Unser Verbandsgebiet zählt 104 Aktiv- und fünf Passivvereine. Ein Viertel davon sind Ausländerclubs - gesamtschweizerisch gesehen ist dies ein sehr hoher Prozentsatz. Diese Clubs werden immer zahlreicher, weil diese Menschen ihre Identität, ihre Herkunft mit einem eigenen Verein verständlicherweise auch nach aussen zeigen wollen“ (Hans-Jürg Ringgenberg vor der Saison 1999/2000)
„Schweizer sind in den Fussballclubs mittlerweile dünn gesät. Schauen sie mal bei uns die Pampers an, da gibt es kaum Schweizer. Und ich muss halt auch sagen, dass viele Ausländer eine bessere Einstellung haben. Die stehen in jedem Training auf dem Platz (...) Es gehen nicht mehr so viele junge Leute Fussball spielen, das hängt mit unserer Gesellschaft zusammen. Das Problem der Schweizer ist die Mentalität: es ist ein Wohlstandsproblem“ (Trainerstimmen in der BaZ, 18.8.2000)
„Letzte Saison hat die SpiKo zweimal die Neuansetzung eines Spiels verschlampt, so dass wir zweimal forfait verloren haben und aus der 4. Liga abgestiegen sind. Wir fühlen uns im Stich gelassen und wollen einen neuen Verein gründen“ (A.S., Untersektion FC Laufen Italiano 1995)
„Wir wollten einfach einen eigenen Namen haben, eigene Veranstaltungen organisieren und auf einem eigenen Platz spielen. Bald geben wir unser eigenes Cluborgan heraus“ (D.A., Vize-Präsident des FC Baris Spor 1996)
„Migrantenvereine haben ein grosses Manko: Ihnen fehlen die finanzstarken Sponsoren. Zudem haben sie kaum akademische Mitglieder in ihren Reihen, die Verbindungen zu grossen Geldgebern einfädeln. Fussball ist vor allem für die städtischen Vereine zu teuer. Besonders die Gebühren für die staatlichen Infrastrukturen sind ein grosses Problem“ (Hasan Kanber, zuständig für Ausländer- und Integrationsfragen bei den regionalen Fussballvereinen in der BaZ vom 23.8.2009 - 'Der Sport ist ein Ast der Integration)
US Napoli Basilea:
Die bunt zusammengewürfelte, selbstständig gewordene US Napoli Basilea (AS Timau B) stieg dank einem funktionierenden Kollektiv (aber ohne Spieler, die in der 5. Liga begonnen hatten) unter der Führung von Präsident Antonio Mele und Spiko Angelo Sciortino in die 3. Liga auf („wir wollen mit 'cuore' zum Erfolg kommen, Geld ist bei uns kein Thema“):
„Mit dem Fünftligisten US Napoli, ehemals in der 3. Liga als Timau bekannt, schied im Basler Cup der 'letzte Mohikaner' der unteren Ligen aus, wobei die internationale Truppe fussballerisch durchaus zu gefallen wusste (...) Skandalös jedoch war das Auftreten von US Napoli und dessen Anhängern, die gegen den guten Ref Meier eine wahre Hetzjagd inszenierten“ (Basler Cup Achtelfinals US Napoli - SV Muttenz [2. Liga] 1:5, Basellandschaftliche Zeitung 17.9.1991)
2000 kooperierte sie mit La Coruña, hatte mit zwei Aktiv- und drei Juniorenmannschaften (A, B und C) und 200 Mitgliedern ein gutes Gerüst und schaffte es vorwiegend mit Italienern und Spaniern der dritten Generation 2002 unter ihrem Präsidenten José Areosa in die 2. Liga. Die mit einem neuen Trainer in Angriff genommene Saison entpuppte sich aber als fatal (das Duell der zweiten Meisterschaftsrunde zwischen den beiden Aufsteigern FC Coruña-Napoli und AS Timau wurde auf den Anlagen Pfaffenholz noch 'vor grosser Zuschauerkulisse' ausgetragen. In der fünften Runde setzte es nach zwei Platzverweisen vor der Halbzeit eine für diese Spielklasse seltene 0:11 Klatsche gegen den FC Liestal ab. Am Ende standen nur vier Unentschieden zu Buche). Auch Unregelmässigkeiten bei einem Tranfer wurden publik („bei gewissen Herren im Verband haben wir als Aufsteiger sowieso den falschen Namen“ - Kassier und Sekretär F.G.):
„Die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, dass die so genannten Ausländerclubs in der 2. Liga öfter an den fehlenden Strukturen und instabilen internen Verhältnissen scheitern als an ihren Gegnern (...) Dem euphorischen Aufstieg folgt meist ein Abstieg mit Zerfallserscheinungen. Die vielen administrativen Verpflichtungen überfordern oft solche Vereine“ (Basellandschaftliche Zeitung 12.6.2007)
AC Milan Club Basilea:
Die Spieler des 1992 dank der Vermittlung des Sportamtes auf den staatlichen Anlagen Bachgraben selbstständig gewordenen Vereins wurden hauptsächlich in einem Spielsalon an der Hammerstrasse rekrutiert, an der sich ab 1990 auch das Vereinslokal befand. Sein Anliegen wurde damit umschrieben, die Jungen von der Strasse und vom 'Kiffen' weg aufs Fussballfeld zu locken. Damals gab es in der Schweiz etwa 30 verschiedene AC Milan-Fanclubs, die sich alljährlich auf nationaler Ebene trafen. 2002 stieg man in die 3. Liga auf.
Italia Club Oberwil:
Auch im Leimental entstand 1995 noch ein eigenständiger Verein. 2005 hatte man endlich den Sprung aus der 4. Liga geschafft:
„Der FC Italia-Club Oberwil hat sich per sofort aus der 3. Liga zurückgezogen. Die Baselbieter konnten für einen geregelten Spielbetrieb nicht mehr genügend Aktive stellen“ (BaZ 7.5.2013)
2000/01 wurde der erst 29-jährige Muttenzer Claudio Circhetta (SV Muttenz, FC Internazionale, US Bottecchia), der damals noch italienischer Staatsangehöriger war, Schiedsrichter der Nationalliga A.
2014 und 2015 stiegen die längst aus verschiedenen Nationen aufgestellten US Olympia Basel und AC Rossoneri Lausen in die 2. Liga auf und feierten die grössten Erfolge ihrer Vereinsgeschichte.
Der Calcio unserer tüchtigen Einwanderer hat nicht zuletzt darum an Identität verloren, weil diese längst assimiliert und viele in ihre Heimat zurückgekehrt sind. An ihre Stelle sind andere Fremde, neue Hoffnungen getreten.
(die Assimilation ist ein langwieriger, beidseitiger Prozess, während dem sich die allmähliche Annäherung der Träger der fremden Kultur an diejenige der ansässigen Bevölkerung vollzieht und bei der eine Abschleifung beider Kulturen unvermeidlich ist. Ihre letzte Phase besteht in der Angleichung, die in der Übernahme von Werten und Verhaltensweisen der andern Kultur als mögliche und tatsächliche Bereicherung und nicht mehr als Bedrohung des eigenen Fundus empfunden wird)
Der Anteil ansässiger Ausländer mit einer Spielerlizenz nimmt durch eine bessere Bildung und Berufsqualifikation ab, geht aus den Statistiken hervor. In sozial schlechter gestellten Schichten ist der sportliche Ehrgeiz grösser. 2023 waren immerhin 5,1 Prozent der in der Schweiz lebenden Italiener aktive Fussballer, 2008 waren es noch 6,3 Prozent.
PS: Der Ausländer wird zum besseren Schweizer
Was ist übrig von der Italianità, fragt sich 2023 im Heft 97 das Magazin '12' ('Italianità für alle'). Die AC Rossoneri Lausen und AC Virtus Liestal stehen Zeuge. Unsere südlichen Einwanderer mögen mittlerweile auch Spiegelei mit Rösti, kann man sinnbildlich verstehen. Und: Italiener sind neidische Menschen. Während Ur-Einheimische den Sohnemann zwecks kultureller Ertüchtigung gleich zu den Tifosi schicken (aha), sehen diese ihre Bambini lieber in den traditionell-schweizerischen Vereinen am Ball, wo noch unsere 'klischierten' Werte gelten (ja was jetzt, Schweizer oder nicht?). 'Dass es (damals) hie und da zu Raufereien kam, hätte das Klischee (wieder eines) der gewalttätigen Ausländer erst gefestigt'. Die Spurensuche endet im Clubhaus bei Pasta und Sugo. Ein an den Haaren herbeigezogener Essai über Identität, Vorurteile, (fehlenden) Stolz und Folklore.
- Um einiges ernsthafter hat sich trotz Verniedlichung der früheren Problematik („als die 'Tschinggen' zu laut jubelten“) 2020 das Basler Internetportal 'bajour' dieser fussballerischen Einwanderungsgeschichte angenommen. Mag seine Argumentationslinie („die Betonung schweizerischer Werte war damals Usus“ - aber nein auch, wie konnten wir nur!) eines latent fremdenfeindlichen, national-argwöhnischen Ressentiments politisch erwartbar (und Ausdruck eines nicht minder negativen Verhältnis zum eigenen Selbst) sein, bringt es das 'Spannungsfeld zwischen Segregation und Integration' (Zitat) ohne Ehrenrettung auf den Punkt: „Einerseits treibt man Sport unter seinesgleichen, man redet dieselbe Sprache, man pflegt Traditionen des Herkunftslandes und trägt die eigenen (...) Migrationserfahrungen an die nächste Generation weiter. Andererseits findet eine Integration ins System des Ankunftslandes statt, weil die Migrantenclubs sich mit Behörden, dem Recht und den Verbänden arrangieren müssen (...) und wo der ausländische Gastarbeiter vielleicht den ersten Schritt zur Transformation zum helvetischen Vereinsmeier macht“ (Simon Engel)
Voci:
„Der wichtigste Grund, warum der FC Ferad seit achtzehn Jahren nicht mehr den Platz bekommen könne,
den er verdiene, sei das Fehlen von Eigentümern. Es wurde betont, dass die Teilnehmer des Kongresses,
die Kurdischen Volksversammlungen und die Institutionen, einschließlich der Kurdischen
Volksversammlungen, dem FC Ferad und seinen Mannschaften gleichgültig gegenüberstanden und dass nicht mehr als
120 lizenzierte junge Spieler umherliefen. Die Delegierten betonten, dass der Club eine anständige Vertretung
der kurdischen Identität aufweisen sollte, und sagten, dass Cem Cemal Kavak, ein Märtyrer, der einen wesentlichen
Beitrag zur Vertretung des kurdischen Volkes und der Identität geleistet habe, einen wesentlichen Beitrag geleistet
habe, und dies sollte in absoluten Zahlen fortgesetzt werden (...) Die Manager betonten, dass der Verein jährliche
Durchschnittskosten von rund 30'000 Franken habe und es schwierig sei, Sponsoren zu finden (...) «Wir sind
ein öffentlicher Verein» - Bülent Tanrıverdi, einer der Clubmanager, betonte, dass kurdische Arbeitgeber,
insbesondere Kurden und kurdische Handwerker, den Club schützen sollten“
vom kurdischen Club FC Ferad Basel 2012]
„«An der GV 1968 haben wir 19 Spanier aufgenommen. Gegen den Widerstand einiger weniger brachte ich diese Aufnahme durch. Die aufgeschlossene Haltung unserer an der GV anwesenden Mitglieder diesen Gastarbeitern gegenüber hat mich sehr gefreut. Es ist nun an uns, diesen neuen Spielern als Kameraden entgegenzutreten und sie in unsere Gemeinschaft aufzunehmen. Wir wollen beweisen, dass ein geordneter und gemeinsamer Spielbetrieb trotz Verschiedenheit in Temperament und Sprache sehr gut möglich ist (...)
Eine echte Einheit mit diesen Spaniern gab es eigentlich nie und sie blieben allen Bemühungen unsererseits eine Gruppe für sich. Heute muss ich rückblickend bekennen, dass mein damaliger Optimismus sich leider nicht bestätigte»“ (Walter Schweizer, Präsident des FC St. Clara 1959-1972 - Jubiläumschronik)
_________________________________________
„In den 50er Jahren haben sich einige Italiener entschlossen in die Schweiz auszuwandern. Zahlreich sind sie am Bahnhof Liestal und Umgebung angekommen, mit Koffern, wenig Kleidern aber mit grosser Hoffnung eine bessere Zukunft zu finden. Aus diesen Immigranten stechen die Namen der Brüder De Stefani Lino & Giuseppe, Gardeliano Mario, Milloch Luigi, Soravitto Claudio, Bassetti Gianni, Facchin Amerigo, Scalzozzo Isaia, Bicego Ferdinando, Ciani Marco, Santaro Guido, Candotti Rodolfo, Parusatti Luigi, Arienti Primo 'Pluto' und vielen anderen, hervor. Nach dem sie sich einigermassen eingerichtet haben, beginnen sie zu arbeiten. Nach einem harten Arbeitstag treffen sie sich am Abend bei Marianna’s 'Beizli' in Liestal, spielen Karten und diskutieren über Fussball wie das in Italien so üblich ist. Eines Abends gewinnt Di Stefano Giuseppe 'Beppe' Geld beim Kartenspielen. Er gibt seinem Bruder Lino und dem Freund Bicego den Auftrag einen Fussball zu kaufen. Die beiden fahren nach Basel. In der Heuwaage kaufen sie in einem Sportladen den ersten richtigen Fussball. Für sie alle war dieser Fussbal ein Traum, doch bald wurde dieser Traum Wirklichkeit, als sie am Spielfeldrand der Sportanlage Gitterli in Liestal zu spielen beginnen. Schnell machte sich der Gedanke breit eine Mannschaft zu gründen. Der Wille war gross doch die Zeiten sehr hart. Langsam spricht sich das Gerücht herum, dass in Liestal junge Italiener Fussball spielen, trotz fehlenden finanziellen Mitteln. Nach einiger Zeit gründen sie eine Mannschaft und tragen ihr erstes Freundschaftsspiel in Pratteln aus. 1959 beginnen sie als Untersektion des FC Liestal 2 Jahre zu spielen. Zu dieser Zeit gab es die C.L.I. (Colonia Libera Italiana, Organisation und Treffpunkt der Italiener). Wie wir alle gut wissen, half die C.L.I. den italienischen Einwanderern. Diese Gemeinschaft nimmt die Mannschaft auf und gibt ihr auch einen finanziellen Beitrag sowie 'moralische' Unterstützung. 1961 beginnen sie unter dem Namen C.L.I. zu spielen. 1963 meldet sich der Schweizerische Fussball Verband und gibt aus verschiedenen Gründen, die Anweisung einen ofiziellen Namen für die Mannschaft anzugeben. So haben Marangon und Refosco (beide aus Valdagno, Vicenza) und beide für die sportliche Leitung der C.L.I. verantwortlich, sich entschlossen die Mannschaft A.C. Virtus zu nennen. Während ihrer Jugend spielten sie schon unter diesem Namen in der Heimat im Internat. Nun begannen sie sich mit der Vereinsfarbe auseinander zu setzen. Danilo (ein Mann aus Piemont) wählt die Farbe Granatrot aus, zu ehren des damaligen grossen A.C. Turin. So ist der erste italienische Verein im Baselland entstanden“ (Webseite des Vereins AC VIRTUS LIESTAL)
„Die CLI Colonie Libera Italiana ist am 6. Juni 1960 durch eine Gruppe von Arbeitern, die aus der Region Emilien und ganz Italien in die Region Rheinfelden emigriert waren, gegründet worden. Der erste Präsident und Mitbegründer der CLI hiess Benito Bertani. 1961 wurde eine CLI-Fussballmannschaft durch Luigi Guelfi und Valseno Bussei gegründet und in der 4. Liga angemeldet. Bald wurden auch Erfolge gefeiert und die Mannschaft stieg in die 3. Liga auf (...) Wir bedanken uns beim FC Rheinfelden für ihre jahrelange Unterstützung und die Eingliederung der CLI Sportiva in ihrem Verein“ (Cluborgan des FC RHEINFELDEN zum 50-jährigen Jubiläum, 2011)
„Zwischen 1975 und 1980 mangelte es an Fussballern und die CLI stellte ihren Fussballbetrieb ein. Guglielmo Esposito und Vittorio die Pasqua gründeten 1981 die CLI-Mannschaft schliesslich neu (...) Ich erinnere mich gerne an die schönen Vereinsreisen, z.B. nach Reggio Emilia, oder die jahrelang veranstalteten CLI-Turniere auf dem Schiffacker, als sich Firmensport, Viert- und Fünftliga-Mannschaften aus Rheinfelden und Umgebung miteinander gemessen haben“ (Vittorio di Pasqua und Enzo Marinelli, Cluborgan des FC RHEINFELDEN 2011)
„Versuchsweise bestreitet erstmals eine reine Italiener-Mannschaft die Meisterschaft in der 4. Liga. Schon sehr bald treten zwischen den drei Aktivteams Spannungen auf, die dem Vereinsgeist nicht förderlich sind. Es häufen sich die groben Unsportlichkeiten auf dem Spielfeld, die bis hin zur Bedrohung des Schiedsrichters ausarten. Diese unrühmlichen Zwischenfälle schaden dem Ansehen des Vereins. Auch die Verbandsbehörde ist aufgeschreckt, muss sie sich doch des öfteren mit diesen unliebsamen Vorkomnissen befassen. Am Ende der Saison 1962/63 wird die Italiener-Mannschaft aufgelöst. Es ist aber jedem Spieler freigestellt, in einer der beiden anderen Mannschaften mitzuwirken“ (Jubiläumschronik des FC GELTERKINDEN 1909-2009, Ernst Droll)
„Wir befinden uns in der Schweiz – in Lausen - im Frühling 1962. Eine Gruppe junger Emigranten bekundet die Absicht, eine italienische Fussball-Mannschaft zu gründen. Die Sehnsucht nach der Heimat drückt schwer und der Wunsch, sich vereint zu fühlen, stärkt den Willen, etwas Konkretes zu schaffen (...) Nach kurzer Zeit wird die erste Vorstandssitzung einberufen, welche im Restaurant Bahnhof stattfindet. Gewählt wird als erster Präsident der neugeschaffenen Vereinigung, Giuseppe Propedo. An Arbeit fehlt es nun nicht. Zur Bildung einer Mannschaft sind alle Probleme bis ins letzte Detail zu lösen, Beschaffung der Dress, Entwurf eines Signets, erste Freundschaftsspiele etc. Die meisten Mitglieder sind Fans von Milan, die seinerzeitige Erfolgsmannschaft in Italien. Daher wird der Name Rossoneri auserkoren. Die Trikotfarben sind jene des rotschwarzen Dress der ruhmreichen Elf aus der Lombardei. Aber einer guten Mannschaft sollte auch ein Spielplatz zur Verfügung stehen, sind doch Training und Meisterschaftsspiele auszutragen (...) Das wohlwollende Ansehen gegenüber den Italienern und die sportliche Leidenschaft bewegt die Gemeindeväter ein unbepflanztes Feld in schöner Lage beim Stutz in Lausen zur Verfügung zu stellen. Mit grosser Befriedigung und voller Begeisterung heisst es nun, die Ärmel aufzuschlagen. Das Feld ist auszuebnen, Steine zu entfernen, Löcher aufzufüllen. Für diese Arbeiten wird ein grosser Teil der Freizeit geopfert, sogar am Sonntag trifft man einige am Werk. Es wird dabei manchmal auch die Familie vernachlässigt Wieder zeigt sich die Gemeinde von der guten Seite. Das erforderliche Material zur Bereitstellung des Spielfeldes wird uns zur Verfügung gestellt. Ein weiterer Beweis vom lobenswerten Interesse am ganzen Unternehmen. Nach getaner Arbeit ist es nun soweit, dass das erste Meisterschaftsspiel ausgetragen werden kann. Der Gegner ist die Mannschaft aus Gelterkinden. Das Spiel endet mit einem Sieg der Rossoneri mit 3:1. An diesem Eröffnungsspiel sind Behörde, Vereinsmitglieder und viele von uns zugegen. Im gleichen Jahr wird ein grosses Fest durchgeführt. Der Reingewinn fliesst in die Mannschaftskasse“ (Webseite des Vereins AC ROSSONERI LAUSEN)
„Die Einwanderung von Gastarbeitern aus unserem südlichen Nachbarland in den 50er- und 60er-Jahren machte sich auch im Waldenburgertal bemerkbar (...) An der Vorstandsitzung vom 27. April 1964 äusserte eine Italienerdelegation den Wunsch, einen Fussballclub zu gründen (...) Bereits ab der Saison 1964/65 spielte eine Italienermannschaft unter dem Namen FC Oberdorf a in der 4. Liga (...) Am 6. März 1967 bekam der Vorstand Kenntnis davon, dass auch die Colonia Libera Italiana einen Fussballclub gründen, sich aber nicht der bestehenden Italienermannschaft anschliessen wollte. In politischer Hinsicht hatten Differenzen bestanden (...) Wegen 'mangelnder Anpassungsfähigkeit' wurde ab der Saison 1968/69 keine Italienermannschaft mehr gemeldet. Am 29. November 1971 sprachen aber erneut Vertreter des Circolo Italiano (ein im Januar 1964 entstandener Verein mit kulturellen, sozialen, und sportlichen Interessen) beim Vorstand vor, wieder einen Fussballclub gründen zu wollen (...) Auf die Saison 1993/94 erfolgte der definitive Zusammenschluss der beiden zweiten Mannschaften von Oberdorf und des Circolos“ (Jubiläumschronik des FC OBERDORF 1933-2008, Thomas Schweizer)
„Im Jahr 1965, als die Auswanderung gross war, voll von jungen Menschen mit sportlichen Absichten, war es einfacher gewesen eine Fussballmannschaft zu gründen. Sicherlich in jenen Tagen war es schwieriger sich an die lokalen Unternehmen anzupassen, die Beschimpfungen auf dem Spielfeld während des Fussballspieles zu dulden und trotzdem einen Reiz zu suchen, das Vertrauen in die Schweizer Liga zu bekommen. Bis in die 70er Jahre hatten wir eine gute Anzahl von Spielern aus Timau und dem Friaul“ (Webseite des Vereins AS TIMAU BASEL)
„1968 beschlossen rund zehn italienische Gastarbeiter eine Fussballmannschaft zu gründen. Unterstützung bot die Christliche Vereinigung Italienischer Arbeitnehmer ACLI mit Sitz in Möhlin. Die erwähnte Vereinigung war es dann, welche die ersten Kontakte mit der Gemeinde und dem Fussballclub Möhlin aufnahm. Eine eigene Fussballmannschaft als Untersektion des FC Möhlin-Ryburg sollte ein Zeichen für die Integration der Immigranten sein. Das Projekt wurde angenommen. Die Gemeinde stellte die nötige Infrastruktur zur Verfügung unter der Bedingung, dass sämtliche Anlässe vom FC Möhlin-Ryburg geleitet werden. Eine enge Zusammenarbeit war gefragt. Es lief nicht immer reibungslos, denn unterschiedliche Mentalitäten und zum Teil sprachliche Barrieren erschwerten die Arbeit. Der Spielbetrieb wurde aufgenommen. Die Mannschaft war in Möhlin als US ACLI bekannt, beim Fussballverband aber unter dem Namen FC Möhlin-Ryburg B angemeldet. Die US ACLI nutzte jahrelang das Knowhow vom FC Möhlin. Junioren wurden übernommen und zu Spieler der 'Italiener' geformt. Die ACLI-Verantwortlichen waren gleichzeitig im Trainerstab des Nachwuchs zu finden und leisteten somit eine wertvolle Gegenleistung. Zusammengefasst könnte man behaupten, dass beide Vereine von einander profitiert haben. Die Leitung der Untersektion übernahm ein eigener Vorstand. Im Pfarrei Zentrum Schallen fand man ein geeignetes Clublokal. Das 'ACLI' wurde zum Treffpunkt der Anhänger“ (Webseite des Vereins US ACLI MÖHLIN)
„Die jungen Rocchesi bildeten einen engen sozialen Kreis. Ähnlich wie einst ihre Väter trafen auch sie sich regelmässig
und verbrachten die freie Zeit vor allem mit Fussballspielen. In ihrer Heimat war der Fussball die Freizeitbeschäftigung
schlechthin – die kleine Gemeinde Roccavivara hatte in den 1960er und 70er Jahren sogar zwei eigenständige Fussball-
mannschaften. In Pratteln blieben die jungen Rocchesi ihrer Leidenschaft treu und spielten zu Beginn der 1970er Jahre
zunächst in lockerer, unorganisierter Form auf dem Sportplatz Hexmatt in Pratteln oder im deutschen Inzlingen nahe der
Schweizer Grenze. 1973 entstand aus dem plauschhaften «Tschüttele» unter Freunden ein eigener Fussballverein:
Die jungen Rocchesi gründeten – mit Bezug auf ihre Herkunftsregion Molise – die Fussballmannschaft U.S. Molisana
und spielten als Untersektion des Vereins Internazionale» in der regionalen Meisterschaft mit. Die U.S. Molisana bestand
in den Anfangsjahren fast ausschliesslich aus jungen Männern aus dem Dorf. Es erfüllte sie mit Stolz, als Vertreter ihrer Region,
ja ihres Heimatdorfes, auf dem Fussballplatz aufzulaufen und in der regionalen Meisterschaft mitzuspielen. Es kam für sie
nicht in Frage, sich in eine der bestehenden italienischen Mannschaften wie Bottecchia oder Rossoneri einzugliedern.
Sie wollten vielmehr eine eigene Mannschaft stellen (...) Die U.S. Molisana half den jungen Rocchesi, sich in der Schweiz
wohl zu fühlen und sich über den Fussball mit Schweizern und anderen Zuwanderern zu vernetzen. Dies
zeigte sich auch an der Zusammensetzung der Mannschaft: Sie entwickelte sich von einem geschlossenen Kreis von
Rocchesi zu einer multikulturellen Truppe. In der U.S. Molisana spielten Schweizer und Italiener zusammen, und
auch spätere Einwanderer aus Afrika und dem Balkan. Die Begeisterung für den Fussball schuf den Boden dafür, dass
sich sowohl Italiener und Schweizer, wie auch andere Migrationsgruppen begegneten – zuerst auf dem Fussballplatz,
und allmählich darüber hinaus. Auch der FIFA-Schiedsrichter Claudio Circhetta aus Muttenz spielte in den 1980er Jahren
in der U.S. Molisana mit. Er erinnert sich an eine multikulturelle Mannschaft: «Das war bunt durchmischt. Da waren Schweizer,
Chilenen, Italiener ..., also wirklich Mutikulti»“ (Jennifer Degen - die Fussballmannschaft US MOLISANA PRATTELN)
__________________________________________
„Der FC Black Stars hat 21 Mannschaften, die 400 aktiven Mitglieder stammen aus 71 Nationen. Was auffällt: Früher spielten in jedem Team Italiener, Spanier und Portugiesen. Heute: Nada. Wir haben Norweger, Holländer, Tschechen, ein paar Schweizer, aber kaum noch Italiener oder Spanier. Wer heute Fussball spielt: Leute aus afrikanischen und südamerikanischen Ländern, ebenso Tamilen, vor allem aber Türken und Kosovaren. Unser Problem ist, dass alles extrem teuer geworden ist. Wir müssen von den Mitgliedern mehrere hundert Franken Beitrag verlangen. Unser Sekretariat schreibt ständig Pro Juventute, die Winterhilfe und andere Einrichtungen an, ob sie bereit wären, Spieler aus sozial schwachen Familien zu unterstützen“ (Sportchef und Mäzen Peter Faé, Basellandschaftliche Zeitung 2019)
| nach oben |